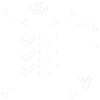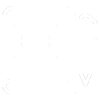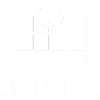Qualitätsleitlinien für die Ärzteausbildung
Die Standard- und Qualitätsleitlinien legen österreichweit Qualitätsstandards für die ärztliche Ausbildung fest. Sie bieten allen Beteiligten - Ausbildungsstätten, Ausbildenden und auszubildenden Ärztinnen und Ärzten - einen Orientierungsrahmen für eine strukturierte medizinische Ausbildung.
Die Leitlinien bieten:
- Klare Standards für Ausbildungsverantwortliche
- Transparente Vorgaben für auszubildende Ärztinnen und Ärzte
- Praxisorientierte Umsetzung durch drei Empfehlungsgrade:
- MUSS: Verpflichtende Vorgaben
- SOLL: Nachdrückliche Empfehlungen
- KANN: Optionale Entwicklungsmöglichkeiten
Die Leitlinien wurden von der Arbeitsgruppe "Standard- und Qualitätsleitlinien der Ärzteausbildung" entwickelt:
- Präs. Dr. Matthias Gabriel Vavrovsky, MBA (Leitung)
- Prim. OMR Dr. Ruth Krumpholz
- Präs. Dr. Peter Niedermoser
- Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak
- Dr. Volker Steindl
- Dr. Severin Ehrengruber
- Dr. Cornelia Anleitner
- Mag. Christiane Kepka (Österreichische Ärztekammer)
Download der Leitlinien:
Im Anschluss finden Sie die digitalisierte Version der Leitlinien:
Standard- und Qualitätsleitlinien der Ärzteausbildung
-
Um die Qualität und Konsistenz der ärztlichen Ausbildung in Österreich zu gewährleisten, hat die Österreichische Ärztekammer (im Folgenden kurz ÖÄK) gegenständliche Leitlinien erarbeitet. Diese Leitlinien legen insbesondere organisatorische und strukturelle Aspekte der ärztlichen Ausbildung fest und bieten eine wichtige Orientierung für medizinische Ausbildungsstätten.
Die Leitlinien zeichnen sich durch verschiedene zentrale Merkmale aus, die eine nachhaltige Verbesserung der medizinischen Ausbildung in Österreich unterstützen.
Qualitätssicherung und -entwicklung sollen durch die Setzung expliziter und nachvollziehbarer Standards gewährleistet werden. Damit soll eine kontinuierliche Verbesserung der Ausbildungsqualität erreicht werden. Durch klare Erwartungen hinsichtlich der Inhalte, Methoden und Ziele organisatorischer und struktureller Aspekte der ärztlichen Ausbildung wird Transparenz gewährleistet. Damit wird eine Objektivität in der Bewertung der Ausbildung unterstützt.Die Leitlinien sorgen zudem für Einheitlichkeit, indem sie konsistente Anforderungen an die ärztliche Ausbildung über verschiedene medizinische Fachbereiche und Institutionen hinweg stellen. Sie sind flexibel gestaltet und an veränderte Anforderungen und Standards in der medizinischen Praxis anpassbar. Dies wird durch regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen gewährleistet, so dass sie stets den neuesten Erkenntnissen und Praktiken entsprechen. Die partizipative Entscheidungsfindung ist ebenfalls ein zentraler Aspekt der Leitlinien, da sie als "Handlungs- und Entscheidungskorridore" gestaltet sind, die es ermöglichen, individuellen Situationen und Bedürfnissen gerecht zu werden.
Die Leitlinien der ÖÄK berücksichtigen die Standards der World Federation for Medical Education (WFME). Diese stellen einen allgemeinen Rahmen dar, der prinzipienbasierte Leitlinien für alle Aspekte der postgradualen medizinischen Ausbildung liefert. Die lokalen Leitlinien sind darauf ausgelegt, auf diese internationalen Standards zu reagieren und sie im spezifischen österreichischen Kontext umzusetzen.
Die zentralen Themenbereiche der Leitlinien umfassen Aspekte wie Ausbildungsplanung und -organisation, die Rolle der Ausbildungsverantwortlichen, die Förderung der Auszubildenden sowie Evaluierungs- und Qualitätssicherungsprozesse.
Als strukturierte Grundlage zur Optimierung der Ausbildungsbedingungen tragen die Leitlinien zur Sicherstellung hoher Ausbildungsstandards bei. Es obliegt den Ausbildungsstätten, die konkrete Umsetzung der Leitlinien vorzunehmen, wobei die Leitlinien eine wertvolle Orientierungshilfe und einen Rahmen für die Planung, Durchführung und Bewertung der ärztlichen Ausbildung darstellen.Alles schließen -
Die Leitlinien der ÖÄK sind in verschiedene Empfehlungsgrade gegliedert. Diese Grade definieren sich durch unterschiedliche Konsensstärken und spielen eine Rolle bei der Umsetzung der Leitlinien in der Praxis.
1. Starker Empfehlungsgrad (E1): Dieser Grad ist durch das Wort "MUSS" in der Formulierung der Empfehlung gekennzeichnet. Die Grundlagen für diese Empfehlung sind entweder eine gesetzliche Vorgabe, eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse oder ein starker standespolitischer Konsens. E1-Empfehlungen repräsentieren die derzeit bestmöglichen Praktiken und die strikte Einhaltung wird in der Regel erwartet.
2. Moderater Empfehlungsgrad (E2): Der E2-Grad ist mit dem Wort "SOLL" in den Leitlinien verankert. Er basiert auf internationalen und nationalen Best Practice-Modellen, Expertenmeinungen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zudem ist ein solider standespolitischer Konsens gegeben. Die E2-Empfehlungen spiegeln bewährte Praktiken wider, die sich in einer Vielzahl von Kontexten als effektiv erwiesen haben. Ihre Umsetzung wird nachdrücklich empfohlen, um einen hohen Standard der ärztlichen Ausbildung zu gewährleisten.
3. Flexibler Empfehlungsgrad (E3): Mit dem Wort "KANN" formuliert, basiert E3 auf Expertenmeinungen, aufstrebenden Praktiken und Konsensprozessen. Diese Empfehlungen bieten Raum für Flexibilität und Individualität in der Umsetzung.
Dieses differenzierte Bewertungssystem ermöglicht den Ausbildungsstätten, die Empfehlungen je nach ihrer Relevanz, Wichtigkeit und Anwendbarkeit in den jeweiligen Ausbildungskontexten zu interpretieren und umzusetzen. Es bietet zudem eine klare Struktur und Orientierungshilfe für den Umgang mit den Leitlinienempfehlungen und deren Integration in die Ausbildungspraxis.
Alles schließen -
-
-
Jede medizinische Ausbildungsstätte ist gemäß den Bestimmungen des Ärztegesetzes (§ 9 Abs 2 Z 5 und § 10 Abs 2 Z 5) verpflichtet, ein schriftliches Konzept vorzulegen, das die Organisationsstruktur und die spezifischen Merkmale der Einrichtung umfassend beschreibt.
Eine klar strukturierte Darstellung der Organisationsstruktur bildet die Grundlage für die Entwicklung eines kohärenten Rotationsplans.
Darüber hinaus ist die detaillierte Darlegung der Leistungsstruktur und der Schwerpunkte jeder Abteilung entscheidend. Sie vereinfacht die gezielte Zuordnung der Ausbildungsärzte auf spezifische Ausbildungsstellen.
Ein transparentes Ausbildungskonzept, das sowohl die Organisations- als auch die Leistungsstruktur der Einrichtung klar aufzeigt, bietet den Ausbildungsärzten eine deutliche Vorstellung der verfügbaren Ausbildungsinhalte, die für die jeweiligen Rasterzeugnisse erforderlich sind.
Zudem sollte das Ausbildungskonzept eine Übersicht über die Ausbildungsverantwortlichen und deren Rollen beinhalten. Für eine vertiefte Erläuterung der Rollenverteilung, insbesondere zwischen dem Abteilungsleiter und dem delegierten Facharzt, wird auf das Kapitel 'Ausbildungsverantwortliche' verwiesen.Gesetzliche Grundlagen§ 9 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin im jeweiligen Fachgebiet ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich
(…)
2. über ein ausreichendes Leistungsspektrum verfügt, um den Turnusärztinnen/Turnusärzten die nach Inhalt und Umfang gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den entsprechenden Fachgebieten zu vermitteln,
3. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt,
(…)
5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.§ 10 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt eines Sonderfaches ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich
(…)
2. über ein ausreichendes Leistungsspektrum verfügt, um den Turnusärztinnen/Turnusärzten die nach Inhalt und Umfang gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten der Sonderfach-Grundausbildung sowie der Sonderfach-Schwerpunktausbildung zu vermitteln,
3. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt,
(…)
5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen unter Berücksichtigung von § 10 Abs. 13 die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.Alles schließen -
Das Ausbildungskonzept (Ausbildungsplan) muss gemäß den Bestimmungen des Ärztegesetzes (§ 9 Abs 2 Z 5 und § 10 Abs 2 Z 5) aufzeigen, wie die im Rasterzeugnis festgelegten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den verschiedenen Organisationseinheiten der Ausbildungsstätte vermittelt werden. Eine sorgfältige Abstimmung der Lernziele des Rasterzeugnisses mit der behördlichen Anerkennung der Ausbildungsstätte ist dabei entscheidend.
Gemäß § 3 der ÄAO 2015 werden 'Kenntnisse' als das für die ärztliche Praxis erforderliche theoretische Wissen definiert, 'Erfahrungen' als empirische Wahrnehmungen aus der Patientenbetreuung und 'Fertigkeiten' als die praktische Anwendung spezifischer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
Das Ausbildungskonzept muss festlegen, in welchen Bereichen der Einrichtung welche Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vermittelt werden, einschließlich eines Zeitrahmens für das Erreichen dieser Lernziele. Zudem sollte das Konzept auch die Methoden ihrer Vermittlung konkretisieren, wie beispielsweise durch die Führung einer Visite, Tätigkeiten in der Ambulanz oder die Anwendung spezifischer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
Für Inhalte des Rasterzeugnisses, die keiner bestimmten Organisationseinheit zugeordnet werden können, muss das Konzept darlegen, wie diese über den gesamten Ausbildungsverlauf hinweg vermittelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Aspekte des Rasterzeugnisses abgedeckt und die notwendigen Kompetenzen von den Ausbildungsärzten erworben werden. Das Ausbildungskonzept soll auch explizit aufzeigen, welche Ausbildungsinhalte nicht innerhalb einer spezifischen Abteilung erlernt werden können, um den Ausbildungsärzten ein umfassendes Verständnis ihrer gesamten Ausbildung zu vermitteln und aufzuzeigen, wo sie gegebenenfalls weitere Kompetenzen erwerben müssen. Durch die klare Struktur und die präzise Verteilung der Lerninhalte im Ausbildungskonzept wird die spätere Überprüfung und Bewertung des Lernfortschritts erleichtert. Ein wohlüberlegter Rotationsplan, der die verschiedenen Organisationseinheiten einbezieht, stellt sicher, dass die Ausbildungsärzte ihre Ausbildung innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfolgreich absolvieren. Die zeitliche Festlegung der Ausbildungsinhalte ermöglicht zudem bei Unterbrechungen der Ausbildung klar zu bestimmen, welche Lernziele noch zu erfüllen sind.
Gesetzliche Grundlagen§ 9 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin im jeweiligen Fachgebiet ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich
(…)
2. über ein ausreichendes Leistungsspektrum verfügt, um den Turnusärztinnen/Turnusärzten die nach Inhalt und Umfang gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den entsprechenden Fachgebieten zu vermitteln,
3. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt,
(…)
5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.§ 10 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt eines Sonderfaches ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich
(…)
2. über ein ausreichendes Leistungsspektrum verfügt, um den Turnusärztinnen/Turnusärzten die nach Inhalt und Umfang gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten der Sonderfach-Grundausbildung sowie der Sonderfach-Schwerpunktausbildung zu vermitteln,
3. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt,
(…)
5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen unter Berücksichtigung von § 10 Abs. 13 die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.§ 3 ÄAO 2015 Im Geltungsbereich dieser Verordnung sind folgende Begriffsbestimmungen maßgebend:
(…)
7. „Erfahrungen“ bezeichnen jene empirischen Wahrnehmungen ärztlicher Tätigkeiten in aktiver und passiver Rolle im Zuge der Betreuung von Patientinnen/Patienten, die in der Folge im Rahmen der eigenen ärztlichen Tätigkeit verwertet werden sollen.
8. „Fertigkeiten“ bezeichnen jene ärztlichen Tätigkeiten, die die Ärztin/der Arzt unmittelbar am oder mittelbar für Menschen ausführt, insbesondere die praktische Anwendung bestimmter Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie sonstige manuelle technische Handlungen.
9. „Kenntnisse“ bezeichnen das theoretische Wissen als Grundlage für die praktische Ausführung ärztlicher Tätigkeiten einschließlich des Wissens über
a) Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anderer ärztlicher oder sonstiger gesundheitsberuflicher Tätigkeitsbereiche sowie
b) die Interpretation von Befunden und Berichten von Ärztinnen/Ärzten anderer medizinischer Fachrichtungen sowie von Angehörigen sonstiger Gesundheitsberufe im Hinblick auf die eigene ärztliche Tätigkeit.§ 21 Abs 1 ÄAO 2015 Mit Aufnahme einer allgemeinärztlichen oder der fachärztlichen Ausbildung ist der Turnusärztin/dem Turnusarzt vom Träger der Ausbildungsstätte ein Ausbildungsplan vorzulegen, der die geplante Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zeitlich und inhaltlich strukturiert darstellt. Abweichungen vom erstellten Ausbildungsplan sind nur bei sachlicher Begründung zulässig. Bei eingeschränktem Anerkennungsausmaß einer Ausbildungsstätte ist im Ausbildungsplan auszuweisen, wie durch die Kooperation mit einer anderen Ausbildungsstätte, einer Lehrpraxis, einer Lehrgruppenpraxis oder einem Lehrambulatorium die Ausbildung zur Gänze vermittelt werden kann.
Alles schließen -
§ 5 KEF- und RZ-VO 2015 sieht vor, dass Ärzte in allen zu vermittelnden Ausbildungsinhalten auch in verschiedenen ärztlichen Rollen gefördert werden sollen. Diese Rollen umfassen den Kommunikator (Communicator), Gelehrten (Scholar), Manager, Fachexperte (Professional), Zusammenarbeiter (Collaborator) und Fürsprecher der Patienten (Health Advocate).
Das Ausbildungskonzept kann aufzeigen, durch welche spezifischen Maßnahmen essenzielle ärztliche Rollenbilder in der Ausbildung gefördert werden, um eine zielgerichtete und effektive Entwicklung grundlegender Kompetenzen bei den Ausbildungsärzten sicherzustellen.
Als Kommunikator sollen die Ausbildungsärzte beispielsweise in der klaren Informationsübermittlung, des effektiven Zuhörens und der empathischen Gesprächsführung geschult werden. In der Rolle des Gelehrten liegt der Fokus auf der Förderung von lebenslangem Lernen, wissenschaftlicher Forschung und Lehre. Als Manager sollen die Ausbildungsärzte Kompetenzen in der Verwaltung von Ressourcen, im Zeitmanagement und in der Qualitätsverbesserung entwickeln. In der Rolle des Fachexperten werden Ethik, Integrität und Verpflichtung gegenüber Patienten hervorgehoben.
Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, der Respekt für andere Fachkenntnisse und effektive Konfliktlösung stehen im Mittelpunkt der Rolle des Zusammenarbeiters. Als Fürsprecher für die Patienten sollen die Ausbildungsärzte lernen, Patientenrechte und -interessen zu vertreten und ein Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln.
Diese Rollenbilder, die sich am CanMEDS-Framework orientieren, bieten einen strukturierten Ansatz zur Förderung verschiedener ärztlicher Kompetenzen. Ursprünglich von der Royal College of Physicians and Surgeons of Canada entwickelt, deckt das CanMEDS-Framework ein breites Spektrum an Fähigkeiten ab, die für die medizinische Praxis wichtig sind. Durch die Einbettung dieser Rollenbilder in die Ausbildung werden Ausbildungsärzte nicht nur in medizinischem Fachwissen, sondern auch in entscheidenden Soft Skills wie Kommunikation, Teamarbeit und ethischem Handeln geschult.
Das CanMEDS-Framework hat sich international als effektives Modell für die medizinische Ausbildung etabliert und trägt dazu bei, die Ausbildungsstandards zu vereinheitlichen.
In Kombination mit den spezifischen Anforderungen der KEF- und RZ VO 2015 stellt die Orientierung an diesen Rollenbildern sicher, dass Ausbildungsärzte eine umfassende, praxisorientierte und an internationalen Standards ausgerichtete Ausbildung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen§ 5 Abs 1 KEF und RZ-V 2015 In allen Bereichen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hat die/der Ausbildungsverantwortliche darauf zu achten, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt auch in folgenden ärztlichen Rollen gefördert wird: a) der Kommunikation (Communicator), b) der Zusammenarbeit (Collaborator), c) der Fähigkeit für ein lebenslanges Lernen (Scholar), d) der Bereitschaft, als Fürsprecher des Patienten einzustehen (Health Advocate) e) einer ethisch ärztlichen Haltung (Professional) sowie f) des Managements (Manager).
(2) Der Ausbildungsverantwortliche hat darauf zu achten, dass diese Grundkompetenzen der Turnusärztin/dem Turnusarzt vermittelt werden.Alles schließen -
Die Integration spezifischer Ausbildungsdetails ins Ausbildungskonzept dient der Transparenz und Klarheit über die Absichten der Ausbildungsstätte in den jeweiligen Bereichen. Dies unterstützt die konkrete Durchführung und die regelmäßige Evaluation der Inhalte und hilft den Ausbildungsärzten, die gesetzten Ziele und Methoden zu verstehen.
Die Ausbildungskonzepte sollen darlegen, wie Ausbildungsärzte in den klinischen Alltag integriert und anhand welcher Methoden Lerninhalte vermittelt werden. Dies beinhaltet ihre aktive Teilnahme an Morgenbesprechungen, interdisziplinären Boards, Visiten und der Arbeit in der Ambulanz sowie das Erlernen spezifischer Behandlungs- und Diagnoseverfahren.
Zur Fort- und Weiterbildung sollten Ausbildungskonzepte strukturierte Informationen zu internen und externen Angeboten bieten und dabei die aktive Beteiligung der Ausbildungsärzte, beispielsweise durch eigene Beiträge, hervorheben.
Die Bereitstellung und Nutzung von Lehrmaterialien und Ressourcen, einschließlich digitaler Lernwerkzeuge und Fachliteratur, sollte im Ausbildungskonzept beschrieben sein. Ausbildungskonzepte sollen detaillierte Prozesse für Leistungsbeurteilung, Evaluierung, Qualitätssicherung und die Einbindung von Feedback der Ausbildungsärzte enthalten. Ergänzende Unterstützungsmaßnahmen wie Mentoring, Supervision und psychosoziale Hilfsangebote können ebenfalls integriert werden.
Für weiterführende Informationen zur Umsetzung dieser Empfehlungen wird auf das entsprechende Kapitel in der Leitlinie verwiesen.
Alles schließen -
Die Empfehlungen zur regelmäßigen Überarbeitung des Ausbildungskonzepts basieren auf der Notwendigkeit, die Ausbildungsinhalte und -methoden stets aktuell und praxisrelevant zu halten. Es wird empfohlen im Ausbildungskonzept festzulegen, unter welchen Umständen eine Überarbeitung erforderlich wird. Anlassbezogene Überarbeitungen können beispielsweise durch maßgebliche Veränderungen in der Ausbildungsstätte, durch Änderungen der gesetzlichen Vorgaben oder durch einen Wechsel der Ausbildungsverantwortlichen notwendig werden.
Die Überarbeitung des Ausbildungskonzepts kann aber auch in festgelegten Zyklen zB alle 3 Jahre erfolgen.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Anpassung des Konzepts ist die Feststellung, dass die praktische Umsetzbarkeit der aktuellen Ausbildungsstruktur nicht mehr gegeben ist. Dies kann aufgrund von Ressourcenengpässen oder geänderten Bedingungen der Fall sein.
Bei der Überprüfung und Anpassung des Ausbildungskonzepts ist es entscheidend, möglichst viele Beteiligte einzubeziehen.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 6 ÄrzteG 1998 Der Träger der Ausbildungsstätte hat jede Änderung der für die Anerkennung und für den Fortbestand als Ausbildungsstätte oder einer Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.
Alles schließen -
Die Empfehlung zielt darauf ab, durch die aktive Kommunikation und Bereitstellung der Ausbildungskonzepte Transparenz und ein Verständnis der Ausbildungsziele und -methoden bei den Ausbildungsärzten zu fördern. Zu Beginn ihrer Ausbildung sollten die Ausbildungsärzte das Konzept erhalten, um sofortigen Zugang zu allen relevanten Informationen zu haben. Die öffentliche Zugänglichkeit der Ausbildungskonzepte, beispielsweise über Online-Plattformen oder Intranet der Ausbildungsstätte, stellt sicher, dass alle Beteiligten – Ausbildungsärzte, Lehrpersonal und Verwaltung – über die gleichen Informationen verfügen und somit eine konsistente Ausbildungsqualität gewährleistet wird. Dies fördert zudem das Engagement und die Eigeninitiative der Ausbildungsärzte, da sie genau verstehen, was von ihnen erwartet wird und wie ihre Ausbildung strukturiert ist.
Gesetzliche Grundlagen§ 21 Abs 1 ÄAO 2015 Mit Aufnahme einer allgemeinärztlichen oder der fachärztlichen Ausbildung ist der Turnusärztin/dem Turnusarzt vom Träger der Ausbildungsstätte ein Ausbildungsplan vorzulegen, der die geplante Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zeitlich und inhaltlich strukturiert darstellt. Abweichungen vom erstellten Ausbildungsplan sind nur bei sachlicher Begründung zulässig. Bei eingeschränktem Anerkennungsausmaß einer Ausbildungsstätte ist im Ausbildungsplan auszuweisen, wie durch die Kooperation mit einer anderen Ausbildungsstätte, einer Lehrpraxis, einer Lehrgruppenpraxis oder einem Lehrambulatorium die Ausbildung zur Gänze vermittelt werden kann.
Alles schließen
-
-
-
Maximale Transparenz und Klarheit in der Kommunikation mit den Ausbildungsärzten sind entscheidend, besonders im Hinblick auf die Rotationspläne. Eine langfristige Planung dieser Rotationen ist wichtig, um den Ausbildungsärzten genügend Zeit für die Vorbereitung auf die verschiedenen Ausbildungsabschnitte zu geben. Die frühzeitige Bereitstellung der Rotationspläne ermöglicht es den Ausbildungsärzten, sich effektiv auf die bevorstehenden Phasen ihrer Ausbildung einzustellen. Zudem ist es wichtig, dass die Ausbildungsärzte umfassend über die Ziele jeder Rotation informiert sind, um zu verstehen, welche Kompetenzen und Kenntnisse in jedem Ausbildungsabschnitt erworben werden sollen.
Um diese Informationen effizient bereitzustellen und kohärente Ausbildungspläne zu erstellen, können elektronische Lösungen wie Online-Plattformen oder spezialisierte Ausbildungsmanagement-Software hilfreich sein. Diese ermöglichen eine zentrale Aktualisierung und Kommunikation der Rotationspläne, erleichtern eventuelle Anpassungen und steigern die Transparenz für die Ausbildungsärzte. Solche Systeme tragen nicht nur zur Reduzierung des administrativen Aufwands bei, sondern verbessern auch die Gesamteffizienz und Effektivität der Ausbildungsplanung und -kommunikation.
Gesetzliche Grundlagen§ 21 Abs 1 ÄAO 2015 Mit Aufnahme einer allgemeinärztlichen oder der fachärztlichen Ausbildung ist der Turnusärztin/dem Turnusarzt vom Träger der Ausbildungsstätte ein Ausbildungsplan vorzulegen, der die geplante Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zeitlich und inhaltlich strukturiert darstellt. Abweichungen vom erstellten Ausbildungsplan sind nur bei sachlicher Begründung zulässig. Bei eingeschränktem Anerkennungsausmaß einer Ausbildungsstätte ist im Ausbildungsplan auszuweisen, wie durch die Kooperation mit einer anderen Ausbildungsstätte, einer Lehrpraxis, einer Lehrgruppenpraxis oder einem Lehrambulatorium die Ausbildung zur Gänze vermittelt werden kann.
Alles schließen -
Die Integration von Rotationen an unterschiedliche Ausbildungsstätten, einschließlich solcher mit verschiedenen Versorgungsstufen sowie an Lehrpraxen und Lehrambulatorien ist eine wertvolle Bereicherung für die Ausbildung. Diese Diversität ermöglicht es Ausbildungsärzten, ein breites Spektrum klinischer Erfahrungen in unterschiedlichen medizinischen Settings zu sammeln und ihre praktischen Fähigkeiten umfassend zu entwickeln.
Gemäß § 8 ÄrzteG 1998 und § 18 ÄAO 2015 ist es möglich, bis zu 24 Monate in anerkannten Lehr(gruppen)praxen oder Lehrambulatorien zu verbringen, was den Ausbildungsärzten ermöglicht, neben herkömmlichen Krankenhausumgebungen, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln und die Vielfalt ihrer klinischen Ausbildung zu erweitern.
Internationale Beispiele, wie die Residency-Programme in Ländern wie den USA, Kanada und Großbritannien, bestätigen den Wert solch vielseitiger Rotationen. Sie fördern ein tiefgreifendes klinisches Verständnis und wichtige Fähigkeiten wie Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, was für die berufliche Entwicklung der Ausbildungsärzte entscheidend ist. Diese Erfahrungen unterstützen die Ausbildungsärzte dabei ihre beruflichen Interessen zu identifizieren und eine gezielte Spezialisierung vorzunehmen.
Ausbildungsstätten spielen eine Schlüsselrolle, indem sie durch gezielte Kooperationen mit verschiedenen medizinischen Einrichtungen die Durchführung dieser Rotationen unterstützen und steuern. Solche Partnerschaften erleichtern die Organisation und Koordination der Rotationen und ermöglichen es den Ausbildungsärzten, nahtlos zwischen unterschiedlichen Lernumgebungen zu wechseln, was die Qualität und Vielfalt ihrer Ausbildungserfahrung erheblich steigert.
Gesetzliche Grundlagen§ 8 Abs 4 ÄrzteG 1998 Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszieles vereinbar ist, kann jeweils ein Teil der Sonderfach-Grundausbildung sowie der Sonderfach-Schwerpunktausbildung bis zu einer in der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 festzulegenden Dauer von insgesamt höchstens vierundzwanzig Monaten in Lehrpraxen oder Lehrgruppenpraxen niedergelassener Fachärztinnen/Fachärzte oder in Lehrambulatorien absolviert werden. Unbeschadet der Tätigkeit in einer Lehrpraxis, einer Lehrgruppenpraxis oder einem Lehrambulatorium gemäß § 12, § 12a und § 13 ist zusätzlich auch das unselbständige Tätigwerden entsprechend der bisher erworbenen Kompetenzen in einem Fachgebiet der Ausbildung zum Facharzt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses in einer Ausbildungsstätte einer Krankenanstalt zulässig.
§ 18 Abs 1 ÄAO 2015 Fachärztliche Ausbildungszeiten, die jeweils in der Dauer von zumindest drei Monaten, oder bei Vorgabe einer Pflichtrotation in der Dauer von zumindest sechs Monaten, in solchen für die Sonderfach-Grundausbildung oder Sonderfach-Schwerpunktausbildung entsprechend anerkannten Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen oder Lehrambulatorien absolviert werden, können in der Gesamtdauer von insgesamt höchstens 24 Monaten angerechnet werden, soweit es mit Erreichung des jeweiligen Ausbildungsziels vereinbar ist.
(…)
Abs 3 Ausbildungsabschnitte, die gemäß Abs. 1 in Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen oder Lehrambulatorien absolviert werden, haben die Ausbildung in Krankenanstalten durch das Kennenlernen vor allem von außerklinischen, unselektierten Krankheitsfällen im Rahmen der ärztlichen Primärversorgung praxis- und patientinnen-/patientenorientiert zu ergänzen.§ 21 Abs 2 ÄAO 2015 Im Rahmen der fachärztlichen Ausbildung kann der Ausbildungsplan auch die Rotation an andere Ausbildungsstätten jeweils mit höherer oder niedrigerer Versorgungsstufe, Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen oder Lehrambulatorien darstellen.
Alles schließen -
In der medizinischen Ausbildung ist es entscheidend, dass Ausbildungsstätten ihren Ärzten eine umfassende Ausbildung innerhalb der vorgegebenen Zeit bieten. Besonders Einrichtungen mit eingeschränktem Anerkennungsausmaß sollten Kooperationen mit anderen anerkannten Ausbildungsstätten, Lehr(gruppen)praxen oder Lehrambulatorien etablieren, um die vollständige Vermittlung aller erforderlichen Ausbildungsinhalte zu gewährleisten.
Gemäß § 21 Abs 1 ÄAO 2015 müssen Ausbildungsstätten mit eingeschränktem Anerkennungsausmaß in ihren Ausbildungsplänen aufzeigen, wie durch Kooperationen eine vollständige Ausbildung ermöglicht wird. Dies gilt vorrangig für die Sonderfach-Grundausbildung in Einrichtungen, die nur als Teil-Ausbildungsstätten anerkannt sind und nicht das gesamte Spektrum an Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten des jeweiligen Rasterzeugnisses vermitteln können.
In der Sonderfach-Schwerpunktausbildung sieht § 18 Abs 4 ÄAO 2015 vor, dass bei eingeschränkter Anerkennung bezüglich eines neunmonatigen Moduls der Ausbildung, ausgenommen das wissenschaftliche Modul, die notwendigen Inhalte durch Kooperationen mit anderen anerkannten Einrichtungen vermittelt werden. Dies gewährleistet, dass Ausbildungsärzte auch dann eine vollständige Ausbildung in diesen Modulen erhalten, wenn diese in ihrer Stammeinrichtung nicht angeboten werden.
Jedes medizinische Ausbildungskonzept sollte daher klar darlegen, welche Kooperationen bestehen und wie diese strukturiert sind, um eine lückenlose Ausbildung zu gewährleisten. Die Ausbildungsstätte übernimmt die Verantwortung für die Initiierung und Koordination dieser Partnerschaften, sodass ein möglichst lückenloser Übergang zwischen den Ausbildungsteilen ermöglicht werden kann.
Gesetzliche Grundlagen§ 18 Abs 4 ÄAO 2015 Im Fall des eingeschränkten Anerkennungsausmaßes einer Ausbildungsstätte hinsichtlich eines die Dauer von neun Monaten umfassenden Moduls der Sonderfach-Schwerpunktausbildung, ausgenommen das wissenschaftliche Modul, ist durch Kooperation mit einer anderen anerkannten Ausbildungsstätte oder Lehrambulatorium oder bewilligten Lehrpraxis oder Lehrgruppenpraxis zu gewährleisten, dass die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in diesem Modul der Sonderfach-Schwerpunktausbildung zur Gänze vermittelt werden können.
§ 21 ÄAO 2015 (1) Mit Aufnahme einer allgemeinärztlichen oder der fachärztlichen Ausbildung ist der Turnusärztin/dem Turnusarzt vom Träger der Ausbildungsstätte ein Ausbildungsplan vorzulegen, der die geplante Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zeitlich und inhaltlich strukturiert darstellt. Abweichungen vom erstellten Ausbildungsplan sind nur bei sachlicher Begründung zulässig. Bei eingeschränktem Anerkennungsausmaß einer Ausbildungsstätte ist im Ausbildungsplan auszuweisen, wie durch die Kooperation mit einer anderen Ausbildungsstätte, einer Lehrpraxis, einer Lehrgruppenpraxis oder einem Lehrambulatorium die Ausbildung zur Gänze vermittelt werden kann.
(2) Im Rahmen der fachärztlichen Ausbildung kann der Ausbildungsplan auch die Rotation an andere Ausbildungsstätten jeweils mit höherer oder niedrigerer Versorgungsstufe, Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen oder Lehrambulatorien darstellen.Alles schließen
-
-
-
-
Die ärztliche Ausbildung erfordert eine umfassende Leistungsbeurteilung, die sowohl formative als auch summative Elemente umfasst, um den Auszubildenden kontinuierliches Feedback sowie eine abschließende Bewertung ihrer Kompetenzen zu ermöglichen.
Gemäß § 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 müssen die Ausbildungsinhalte, darunter spezifische Kenntnisse, praktische Erfahrungen und klinische Fertigkeiten, nicht nur durchgehend während der Ausbildungszeit überwacht, sondern auch aktiv bewertet und abschließend überprüft werden. Diese Vorgabe gewährleistet, dass die Vermittlung der Inhalte den Vorschriften der Rasterzeugnisse (siehe Anlagen in der KEF und RZ-VO 2015) entspricht. Die Rasterzeugnisse dienen als maßgebliche Grundlage, die nicht nur die erforderlichen theoretischen Kenntnisse und die aus der Patientenversorgung gewonnenen Erfahrungen definiert, sondern auch sicherstellt, dass die praktischen Fertigkeiten entsprechend erlernt werden.
Die formative Beurteilung, die auf dem Feedback der Ärzte beruht, mit denen der Ausbildungsarzt direkt zusammenarbeitet, bietet fortlaufende Rückmeldungen. Diese dienen den Ausbildungsärzten als wesentliche Orientierungshilfe, um ihre Fähigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich während der gesamten Ausbildungszeit zu verbessern. Die strukturierte Durchführung von Feedbackgesprächen sowie der Einsatz standardisierter arbeitsplatzbasierter Beurteilungsinstrumente tragen wesentlich zur Effektivität der formativen Beurteilung bei. Es ist zudem erforderlich, dass Ausbildungsärzte dazu angehalten werden, Logbücher zu führen und ihre Leistungen eigenständig zu erfassen. Dies ermöglicht ihnen, ihren eigenen Lernfortschritt lückenlos zu dokumentieren und zu überwachen, fördert die Selbstreflexion und vertieft das Verständnis der Lernziele.
Die summative Beurteilung dient als abschließendes Bewertungselement am Ende eines Ausbildungsabschnitts und nutzt strukturierte Evaluierungsgespräche mit dem Ausbildungsverantwortlichen als ihr Kerninstrument. Diese Gespräche, die zu gesetzlich festgelegten Zeitpunkten abgehalten werden müssen, führen zur Ausstellung eines Rasterzeugnisses, welches die formal erreichten Kompetenzen der Ausbildungsärzte bestätigt. Wesentlich ist, dass diese Beurteilung die Erreichung der Lernziele überprüft und eine fundierte Beurteilung der ärztlichen Praxisfähigkeit in qualitativer und quantitativer Hinsicht bietet. Darüber hinaus zielen die Gespräche darauf ab, eine umfassende Rückmeldung zu liefern, die Stärken und Entwicklungspotenziale gleichermaßen beleuchtet und den Ausbildungsärzten Orientierung für ihre zukünftige berufliche Ausbildung und Entwicklung gibt.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem Turnusarzt in dem in den Rasterzeugnissen für die jeweiligen Fachgebiete angeführten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. Auf Verlangen des Turnusarztes hat der Ausbildungsverantwortliche nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung oder nach jeder Rotationsabteilung in der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen auszustellen.
§ 19 Abs 1 ÄAO 2015 Der Erfolgsnachweis über die Basisausbildung, die allgemeinärztliche und fachärztliche Ausbildung besteht aus einem oder mehreren Rasterzeugnissen.
(2) Die Rasterzeugnisse haben
1. den Inhalt (die vermittelten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Basisausbildung und in den jeweiligen Fachgebieten) sowie
2. die Dauer der jeweiligen Fachgebiete der allgemeinärztlichen Ausbildung, der Sonderfach-Grundausbildung und Sonderfach-Schwerpunktausbildung
anzugeben sowie die Feststellung zu enthalten, ob die Ausbildung mit Erfolg oder ohne Erfolg zurückgelegt worden ist.§ 23 Abs 1 ÄAO 2015 Die/der Ausbildungsverantwortliche hat nach Zurücklegung der Mindestausbildungszeiten in den jeweiligen Ausbildungsabschnitten im Sinne des § 3 Z 1, 4 und 6 sowie nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung und, sofern ein Modul die Dauer von mehr als 24 Monaten umfasst, nach der Hälfte der Modulausbildungszeit, unverzüglich die entsprechenden Rasterzeugnisse auszustellen und der Turnusärztin/dem Turnusarzt allenfalls Gelegenheit zu geben, den Empfang der Rasterzeugnisse schriftlich zu bestätigen.
§ 4 Abs 1 KEF und RZ-V 2015 Im Rahmen der Basisausbildung sind Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in chirurgischen und konservativen Fachgebieten gemäß Anlage 33 zu erwerben.
Abs 2 In der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin/zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin/zum Facharzt eines Sonderfaches haben Ärztinnen/Ärzte jene Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten nachzuweisen, die in den Anlagen zu dieser Verordnung (Anlagen 1 bis 33) angeführt sind.Alles schließen -
-
Um eine umfassende Dokumentation von Lernerfahrungen, Leistungen und Feedback zu gewährleisten, sind Ausbildungsärzte angehalten, ein Logbuch oder Leistungsportfolio zu führen. Diese Anleitung stützt sich auf Vorgaben in der ÄAO 2015 und der KEF und RZ-V 2015 (§ 4 Absatz 2), welche die Nachweisführung des Erwerbs von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten fordern.
Durch die Dokumentation ihres Lernfortschritts in Logbüchern oder Portfolios, die ihre Inhalte direkt aus den Rasterzeugnissen ableiten, wird den Ausbildungsärzten ermöglicht, ihren individuellen Fortschritt transparent zu machen und ihre fachliche Entwicklung zu dokumentieren. Diese Methode fördert nicht nur die Selbstreflexion und die Eigeninitiative, indem sie zur aktiven Beschäftigung mit den Lernzielen anregt, sondern ermöglicht den Ausbildungsärzten auch, ihren Fortschritt im Rahmen der Ausbildung zu überblicken und zu identifizieren, welche Bereiche noch Aufmerksamkeit benötigen.
Von den Ausbildungsstätten wird erwartet, dass sie präzise Anleitungen zur Führung und regelmäßigen Überprüfung der Logbücher bereitstellen. Dabei könnte die Integration digitaler Tools und Plattformen erwogen werden, um eine zeitgemäße und effiziente Dokumentation zu ermöglichen.
In Logbüchern oder Leistungsportfolios kann eine Vielzahl von Aktivitäten und Erfahrungen festgehalten werden. Hierzu zählen die Teilnahme an Weiterbildungen, Kongressen und E-Learning-Angeboten, die eingehende Analyse von Fachliteratur sowie detaillierte Darstellungen von Patientenfällen durch anonymisierte Arztbriefe. Zusätzlich lassen sich spezifische praktische Fertigkeiten dokumentieren, wie beispielsweise die Durchführung von Untersuchungen, die Anwendung chirurgischer Verfahren oder die Mitwirkung bei Notfalleinsätzen. Ebenso ist die Dokumentation von strukturierten Feedbackgesprächen mit Kollegen oder arbeitsplatzbasierten Beurteilungen möglich.Diese systematische Erfassung ihrer Leistungen durch die Ausbildungsärzte dient den Ausbildungsverantwortlichen in weiterer Folge als Grundlage für eine fundierte Beurteilung des Ausbildungsverlaufs im Rahmen des summativen Evaluierungsgespräches.
Gesetzliche Grundlagen§ 20 ÄAO 2015 Die Rasterzeugnisformulare sind der Turnusärztin/dem Turnusarzt von der/dem Ausbildungsverantwortlichen am Beginn der Ausbildung in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen.
§ 4 Abs 1 KEF und RZ-V 2015 Im Rahmen der Basisausbildung sind Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in chirurgischen und konservativen Fachgebieten gemäß Anlage 33 zu erwerben.
Abs 2 In der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin/zum Arzt für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin/zum Facharzt eines Sonderfaches haben Ärztinnen/Ärzte jene Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten nachzuweisen, die in den Anlagen zu dieser Verordnung (Anlagen 1 bis 33) angeführt sind.§ 9 KEF und RZ-V 2015 (1) Ausbildungsbücher (sogenannte Logbücher) der Österreichischen Ärztekammer dienen zur detaillierten Dokumentation der einzelnen Ausbildungsschritte durch die Turnusärztin/den Turnusarzt und sind von der Turnusärztin/vom Turnusarzt und der/dem Ausbildungsverantwortlichen zu verwenden. (2) Das Ausbildungsbuch soll der/dem in Ausbildung befindlichen Ärztin/Arzt im Nachweis der erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten unterstützen. (3) Der Inhalt der Ausbildungsbücher ergibt sich aus dem Inhalt der Rasterzeugnisse.
Alles schließen -
Die Nutzung elektronischer Krankeninformationssysteme bietet Ausbildungsstätten die Chance, systemische Auswertungen zu erstellen, die transparent machen, welche ausbildungsrelevanten Erfahrungen und Fertigkeiten Ausbildungsärzte bereits erlangt haben. Es wäre ideal, wenn Ausbildungsärzte und Ausbildungsverantwortliche ständigen Zugang zu den für sie relevanten Parametern hätten, um jederzeit den Fortschritt der Ausbildung überblicken zu können. Sollte dies nicht durchgehend möglich sein, sollten zumindest periodisch Auswertungen generiert werden können, die aufzeigen, welche Leistungen erbracht und inwiefern diese Tätigkeiten von den Ausbildungsärzten selbstständig oder im Teamkontext durchgeführt wurden.
In diesem Zusammenhang sollte es möglich sein, innerhalb der elektronischen Leistungserfassung differenzieren zu können, ob der Ausbildungsarzt bestimmte Tätigkeiten eigenständig unter Aufsicht ausgeführt hat (zum Beispiel die Durchführung einer Operation als Hauptoperateur oder die eigenverantwortliche Erstellung eines Arztbriefes) oder ob er Teil eines Teams war (beispielsweise als Erstassistenz bei Operationen oder in der Betreuung von Patienten im Teamverbund).
Um die Zuordnung der bundesweit einheitlichen Diagnosen- und Leistungsdokumentation mittels ICD-10 und die Leistungserfassung nach dem Leistungskatalog zu den im Rasterzeugnis geforderten Fertigkeiten mit entsprechenden Richtzahlen herstellen zu können, stellt das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Definitionshandbuch zur Verfügung. Dies ermöglicht eine technische Zuordnung der erfassten Diagnosen und Leistungen zu den Fertigkeiten in den Rasterzeugnissen. Die Ausbildungsstätten sollten dann eine technische Zuordnung zu den Ausbildungsärzten schaffen, um eine präzise und transparente Übersicht über den Fortschritt und die durchgeführten Leistungen im Rahmen ihrer Ausbildung zu gewährleisten.
Gesetzliche Grundlagen§ 13d ÄrzteG 1998 (1) Die systematische Darstellung von technischen Definitionen von in Ausbildungsstätten gemäß §§ 9 und 10 sowie in Spezialisierungsstätten gemäß § 11a Abs. 2 Z 1 iVm § 11b gemäß der Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 11a Abs. 3 zu vermittelnden Fertigkeiten im Sinne einer Gegenüberstellung von
1. Leistungskennzahlen aus dem Dokumentations- und Informationssystem für Analysen im Gesundheitswesen (DIAG) gemäß dem Bundesgesetz über Dokumentation im Gesundheitswesen und
2. Richtzahlen gemäß der Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 11a Abs. 3
bildet das Definitionenhandbuch der Fertigkeiten für die ärztliche Aus- uns Weiterbildung.
(2) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat das Definitionenhandbuch für die ärztliche Aus- und Weiterbildung unter Mitwirkung der Kommission für die ärztliche Ausbildung gemäß § 6b und der österreichischen Ärztekammer zu erarbeiten, weiterzuentwickeln und als Anlage zur Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 kundzumachen.§ 9 KEF und RZ-V 2015 (1) Ausbildungsbücher (sogenannte Logbücher) der Österreichischen Ärztekammer dienen zur detaillierten Dokumentation der einzelnen Ausbildungsschritte durch die Turnusärztin/den Turnusarzt und sind von der Turnusärztin/vom Turnusarzt und der/dem Ausbildungsverantwortlichen zu verwenden.
(2) Das Ausbildungsbuch soll der/dem in Ausbildung befindlichen Ärztin/Arzt im Nachweis der erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten unterstützen.
(3) Der Inhalt der Ausbildungsbücher ergibt sich aus dem Inhalt der Rasterzeugnisse.§ 4 Abs 3 KEF und RZ-V 2015 Sofern in den Anlagen Fertigkeiten für operative Eingriffe angeführt sind, sind Fertigkeiten in der selbstständigen Durchführung der Operation zu erwerben. Bei Operationen höheren Schwierigkeitsgrades können 20 von 100 der angegebenen Richtzahlen auch als erste Assistenz erfolgen.
Alles schließen -
Arbeitsplatzbasierte Assessments (AbAs), international auch als Workplace-Based Assessments (WBAs) bekannt, sind in der medizinischen Ausbildung weltweit anerkannte Instrumente. Sie sind speziell darauf ausgerichtet, die Leistung und Kompetenz von Ausbildungsärzten direkt in ihrem Arbeitsumfeld zu evaluieren. Diese Verfahren sollen nicht als Prüfungen fungieren, sondern vielmehr als Orientierungshilfen dienen, die es den Ausbildungsärzten ermöglichen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich während ihrer gesamten Ausbildungszeit zu verbessern. Die Methoden erlauben die direkte Beobachtung und Bewertung von praktischen Fähigkeiten, klinischem Urteilsvermögen, professionellem Verhalten und Kommunikationsfähigkeiten in realen klinischen Situationen.
Die Kernaspekte von AbAs umfassen direkte Beobachtungen durch erfahrene Fachärzte, systematische Bewertungen nach vordefinierten Kriterien und das Anbieten von konstruktivem Feedback. Diese strukturierten Elemente dienen dazu, eine individuelle Bestandsaufnahme für die Ausbildungsärzte zu ermöglichen, gezieltes Feedback zu erleichtern und spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Es gibt eine breite Palette von AbAs, die unterschiedliche Aspekte der medizinischen Ausbildung abdecken. Dazu gehören Mini Clinical Evaluation Exercises (Mini-CEX) für die Bewertung klinischer Leistungen, Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) für die Beurteilung klinischer Verfahren, Case-Based Discussions (CBD) zur Bewertung der Entscheidungsfindung, sowie 360-Grad-Feedback für umfassende Einsichten durch Bewertungen von Kollegen und anderen Teammitgliedern. Procedure-Based Assessments (PBA) für chirurgische und andere prozedurale Disziplinen sowie Entrustable Professional Activities (EPAs) werden genutzt, um festzustellen, welche Aufgaben ein Ausbildungsarzt selbstständig ausführen kann.
Die effektive Integration von AbAs in die ärztliche Ausbildung erfordert eine sorgfältige Planung und Evaluation, um festzulegen, welche Assessments in der jeweiligen Ausbildungsstätte eingesetzt werden können. Nach der Auswahl der geeigneten Methoden sollten die Kriterien an den spezifischen Ausbildungskontext angepasst und die Häufigkeit ihrer Anwendung festgelegt werden. Eine qualitativ hochwertige Durchführung dieser Assessments setzt zudem eine umfassende Schulung der Ausbildungsfachärzte voraus.
Durch regelmäßige Anwendung von AbAs lässt sich der Fortschritt der Ausbildungsärzte effektiv überwachen und es kann zeitnah konstruktives Feedback gegeben werden. Darüber hinaus tragen AbAs wesentlich zur Verbesserung der Feedback-, Kommunikations- und Fehlerkultur innerhalb einer Ausbildungsstätte bei.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem Turnusarzt in dem in den Rasterzeugnissen für die jeweiligen Fachgebiete angeführten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. Auf Verlangen des Turnusarztes hat der Ausbildungsverantwortliche nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung oder nach jeder Rotationsabteilung in der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen auszustellen.
§ 5 KEF und RZ-V 2015 (1) In allen Bereichen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hat die/der Ausbildungsverantwortliche darauf zu achten, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt auch in folgenden ärztlichen Rollen gefördert wird: a) der Kommunikation (Communicator), b) der Zusammenarbeit (Collaborator), c) der Fähigkeit für ein lebenslanges Lernen (Scholar), d) der Bereitschaft, als Fürsprecher des Patienten einzustehen (Health Advocate) e) einer ethisch ärztlichen Haltung (Professional) sowie f) des Managements (Manager).
(2) Der Ausbildungsverantwortliche hat darauf zu achten, dass diese Grundkompetenzen der Turnusärztin/dem Turnusarzt vermittelt werden.Alles schließen -
Die effektive Nutzung von arbeitsplatzbasierten Assessments (AbAs), Feedbackgesprächen und formativen Leistungsbeurteilungen erfordert eine konsequente Dokumentation und klare Kommunikation der Ergebnisse an die Ausbildungsärzte und Ausbildungsverantwortlichen. Es ist essenziell, dass diese Informationen systematisch erfasst und zugänglich gemacht werden. Die Dokumentation soll benutzerfreundlich sein und eine klare Übersicht über den individuellen Lernverlauf ermöglichen. Digitale Plattformen können dabei helfen, die Verwaltung und den Zugriff auf Bewertungsdaten zu vereinfachen, was eine zeitnahe Rückmeldung und Anpassung der Ausbildungsziele ermöglicht. Die Schlüsselaspekte sind Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Förderung einer kontinuierlichen, zielgerichteten Entwicklung der Ausbildungsärzte.
Alles schließen
-
-
-
Evaluierungsgespräche sind ein wesentlicher Bestandteil der summativen Leistungsbeurteilung in der medizinischen Ausbildung und Ausbildungsärzte haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Evaluierungsgespräche zu den festgelegten Zeitpunkten. Gemäß § 23 Abs 1 ÄAO 2015 und § 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 sollen diese Gespräche stattfinden, um eine zusammenfassende Bewertung des Ausbildungsfortschritts der Ausbildungsärzte zu ermöglichen und sind mit der formalen Ausstellung eines Rasterzeugnisses verbunden, welches den aktuellen Stand der erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten dokumentiert. Die vorgeschriebenen Zeitpunkte für die Durchführung der Evaluierungsgespräche orientieren sich an der Zurücklegung der Mindestausbildungszeiten, die in der KEF und RZ-V 2015 definiert sind, sowie an der Notwendigkeit, bei längeren Ausbildungsabschnitten Zwischenevaluierungsgespräche zu führen.
Die spezifischen Anforderungen für den Zeitpunkt der Durchführung der Evaluierungsgespräche je nach Ausbildungsstufe lässt sich wie folgt festhalten:
- In der Basisausbildung erfolgt ein Gespräch nach Abschluss der Mindestausbildungszeit und somit nach 9 Monaten.
- In der allgemeinmedizinischen Ausbildung besteht der Anspruch auf ein Evaluierungsgespräch nach Absolvierung der Mindestausbildungszeit in der jeweiligen Fachrotation.
- Während der Sonderfach-Grundausbildung sind Evaluierungen zur Halbzeit sowie nach Abschluss jeder Mindestausbildungszeit vorgesehen.
- In der Sonderfach-Schwerpunktausbildung finden die Gespräche nach dem Abschluss der Mindestausbildungszeit in einem Modul statt, bei Modulen mit einer Dauer von mehr als 24 Monaten zusätzlich zur Halbzeit und nach Abschluss der gesamten Sonderfach-Schwerpunktausbildung.
Neben diesen festgelegten Zeitpunkten können auch besondere Umstände ein anlassbezogenes Evaluierungsgespräch erforderlich machen. Solche Anlässe können die Erkenntnis sein, dass Ausbildungsinhalte nicht wie geplant absolviert werden können oder besondere Ereignisse wie das außerplanmäßige Ausscheiden oder eine längere Karenzzeit des Ausbildungsarztes.
Es ist wichtig zu betonen, dass Mitarbeitergespräche nicht als Ersatz für die formellen Evaluierungsgespräche gelten können, es sei denn, sie beinhalten eine ausführliche Beurteilung der ausbildungsrelevanten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sowie die Ausstellung eines Rasterzeugnisses.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem Turnusarzt in dem in den Rasterzeugnissen für die jeweiligen Fachgebiete angeführten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. Auf Verlangen des Turnusarztes hat der Ausbildungsverantwortliche nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung oder nach jeder Rotationsabteilung in der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen auszustellen.
§ 22 ÄAO 2015 Der Ausstellung der Rasterzeugnisse hat zeitnah zu den gemäß § 23 festgelegten Zeitpunkten ein auf die fachliche Ausbildung bezogenes Evaluierungsgespräch zwischen der/dem Ausbildungsverantwortlichen und der Turnusärztin/dem Turnusarzt über den jeweils absolvierten Ausbildungsabschnitt voranzugehen, das von der/dem Ausbildungsverantwortlichen zu dokumentieren ist.
§ 23 Abs 1 ÄAO 2015 Die/der Ausbildungsverantwortliche hat nach Zurücklegung der Mindestausbildungszeiten in den jeweiligen Ausbildungsabschnitten im Sinne des § 3 Z 1, 4 und 6 sowie nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung und, sofern ein Modul die Dauer von mehr als 24 Monaten umfasst, nach der Hälfte der Modulausbildungszeit, unverzüglich die entsprechenden Rasterzeugnisse auszustellen und der Turnusärztin/dem Turnusarzt allenfalls Gelegenheit zu geben, den Empfang der Rasterzeugnisse schriftlich zu bestätigen.
Alles schließen -
Eine zentrale Aufgabe des Ausbildungsverantwortlichen im Evaluierungsgespräch ist es, zu bestätigen, dass Ausbildungsinhalte vermittelt wurden und dass eine regelmäßige Überprüfung der erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten stattgefunden hat.
Die Unterschrift des Ausbildungsverantwortlichen auf dem Rasterzeugnis symbolisiert nicht nur die formelle Bestätigung der vermittelten Inhalte, sondern steht auch als rechtlich bindender Nachweis dafür, dass der Ausbildungsarzt die erforderlichen Lernziele erreicht hat. Gemäß § 4 Abs 4 KEF und RZ-V 2015 dienen die in den Ausbildungsinhalten genannten Zahlen als Richtwerte, die erreicht werden sollen, wobei Abweichungen eine spezifische Begründung des Ausbildungsverantwortlichen benötigen. Wenn für gewisse Fertigkeiten keine Richtzahl festgelegt ist, muss die Vermittlung so erfolgen, dass der Ausbildungsarzt in der Lage ist, diese selbstständig auszuführen.
Für den Ausbildungsverantwortlichen birgt die Unterzeichnung des Rasterzeugnisses eine Verantwortung. Sie bezeugt persönlich, dass die Ausbildungsinhalte angemessen vermittelt und die Leistungen des Ausbildungsarztes gewissenhaft überprüft wurden. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Fragen zur Kompetenz des Arztes aufkommen oder sich herausstellen, dass die Ausbildungsinhalte nicht in der erforderlichen Tiefe behandelt wurden, könnte dies (berufs-)rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Daher ist es von äußerster Wichtigkeit, dass die Unterzeichnung auf einer gründlichen und ehrlichen Bewertung basiert.
Negativ bewertete Ausbildungsinhalte müssen im Rasterzeugnis schriftlich begründet werden, inklusive eines Hinweises darauf, wann und unter welchen Umständen eine positive Absolvierung möglich ist. Sollten Inhalte negativ beurteilt werden, hat der Ausbildungsarzt nach positiver Bewältigung der zuvor negativ beurteilten Inhalte Anspruch auf die Ausstellung eines aktualisierten Zwischenzeugnisses.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem Turnusarzt in dem in den Rasterzeugnissen für die jeweiligen Fachgebiete angeführten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. Auf Verlangen des Turnusarztes hat der Ausbildungsverantwortliche nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung oder nach jeder Rotationsabteilung in der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen auszustellen.
§ 23 ÄAO 2015 (2) Die Vermittlung von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in den jeweiligen in den Rasterzeugnissen aufgelisteten Ausbildungsinhalten ist durch die Ausbildungsverantwortliche/den Ausbildungsverantwortlichen jeweils durch Unterschrift und Datum am Rasterzeugnis zu bestätigen.
(3) Durch die Unterschrift der Ausbildungsverantwortlichen/des Ausbildungsverantwortlichen wird bestätigt, dass der Turnusärztin/dem Turnusarzt die Ausbildungsinhalte im jeweils erforderlichen Umfang tatsächlich vermittelt wurden und die/der Ausbildungsverantwortliche laufend die erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten überprüft hat.
(4) Sollten einzelne Bereiche des Rasterzeugnisses nicht positiv beurteilt werden, so ist dies im Rasterzeugnis schriftlich hinreichend zu begründen.
(5) Nach Ausstellung eines negativen Zeugnisses gemäß Abs. 4 ist auf Verlangen der Turnusärztin/des Turnusarztes nach positiver Absolvierung der vormals negativ beurteilten Tätigkeiten ein weiteres entsprechendes Zwischenzeugnis auszustellen.§ 8 Abs 2 KEF und RZ-V 2015 Das Rasterzeugnis für die Basisausbildung ist vom ärztlichen Leiter der Krankenanstalt, das Rasterzeugnis für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin, für die Sonderfach-Grundausbildung, die Sonderfach-Schwerpunktausbildung sowie für das wissenschaftliche Modul vom Ausbildungsverantwortlichen zu unterfertigen und hat die Feststellung zu enthalten, dass die Ausbildung im jeweiligen Ausbildungsfach mit oder ohne Erfolg absolviert worden ist. Vermittelte und nicht vermittelte Inhalte sind deutlich und nachvollziehbar zu kennzeichnen.
§ 4 Abs 4 KEF und RZ-V 2015 In den Ausbildungsinhalten angeführte Zahlen sind Richtzahlen, die die Turnusärztin/der Turnusarzt im jeweiligen Ausbildungsinhalt erreichen soll; in Einzelfällen kann mit Begründung des Ausbildungsverantwortlichen von der Richtzahl abgewichen werden. Wenn bei einer Fertigkeit keine Richtzahl angeführt ist, bedeutet dies, dass Fertigkeiten im jeweiligen Teilgebiet im Umfang so zu vermitteln sind, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt die jeweilige Fertigkeit selbstständig durchführen kann. Ist bei allfälligen Ausbildungsinhalten gemäß § 3 Z 1 eine Richtzahl angegeben und wird diese Fertigkeit von der Turnusärztin/dem Turnusarzt erworben, so ist die angeführte Richtzahl zu erfüllen, um diesen Ausbildungsinhalt als absolviert nachweisen zu können.
Alles schließen -
Bei der Leistungsbeurteilung in der ärztlichen Ausbildung soll es nicht nur um die quantitative Erfüllung von Lernzielen gehen; eine gründliche qualitative Überprüfung des Kompetenzniveaus der Ausbildungsärzte ist ebenfalls von großer Bedeutung. Diese umfassende Bewertung umfasst neben dem direkten Eindruck, den der Ausbildungsverantwortliche von den Leistungen des Ausbildungsarztes gewonnen hat, auch die Erkenntnisse aus strukturierten Feedbackgesprächen und formativen Leistungsbeurteilungen.
In den Gesprächen, die Teil der laufenden Ausbildung sind und die Vorbereitung auf weitere Ausbildungsabschnitte fokussieren, liegt der Schwerpunkt darauf, wie das Kompetenzniveau der Ausbildungsärzte weiter gesteigert werden kann. Dies beinhaltet das Identifizieren von Stärken, die als Basis für zukünftiges Wachstum dienen können, sowie das Erkennen und gezielte Verbessern von Schwächen.
Bei abschließenden Evaluierungsgesprächen ist es wichtig, die Selbstständigkeit der Ausbildungsärzte in der Ausübung ärztlicher Tätigkeiten zu evaluieren. Diese Selbstständigkeit, als Kernziel der medizinischen Ausbildung, bereitet die Ausbildungsärzte darauf vor, verantwortungsvoll und autonom in ihrem Beruf zu wirken. Es ist entscheidend zu überprüfen, inwiefern die Ausbildungsärzte fähig sind, die im Curriculum festgelegten Inhalte selbstständig anzuwenden und ob sie die erforderlichen Kompetenzen für eine unabhängige Berufsausübung erworben haben.
Ausbildungsverantwortliche sind in einer Position, um die Ausbildungsärzte hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklungspotenziale und Karrieremöglichkeiten zu beraten. Ihre enge Zusammenarbeit und Verständnis für die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Ausbildungsärzte ermöglichen es ihnen, Ratschläge zu geben, die den Ausbildungsärzten helfen, ihre beruflichen Ziele zu erreichen und ihre Karrierepfade zu planen.
Gesetzliche Grundlagen§ 19 ÄAO 2015 (1) Der Erfolgsnachweis über die Basisausbildung, die allgemeinärztliche und fachärztliche Ausbildung besteht aus einem oder mehreren Rasterzeugnissen.
(2) Die Rasterzeugnisse haben
1. den Inhalt (die vermittelten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Basisausbildung und in den jeweiligen Fachgebieten) sowie
2. die Dauer der jeweiligen Fachgebiete der allgemeinärztlichen Ausbildung, der Sonderfach-Grundausbildung und Sonderfach-Schwerpunktausbildung
anzugeben sowie die Feststellung zu enthalten, ob die Ausbildung mit Erfolg oder ohne Erfolg zurückgelegt worden ist.
(3) Die Feststellung gemäß Abs. 2 hat die Beurteilung des fachlichen Wissens und der praktischen Fähigkeiten der Turnusärztin/des Turnusarztes im Hinblick auf die Basiskompetenz sowie die angestrebte allgemeinärztliche oder fachärztliche Tätigkeit zu beinhalten.§ 5 KEF und RZ-V 2015 (1) In allen Bereichen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hat die/der Ausbildungsverantwortliche darauf zu achten, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt auch in folgenden ärztlichen Rollen gefördert wird: a) der Kommunikation (Communicator), b) der Zusammenarbeit (Collaborator), c) der Fähigkeit für ein lebenslanges Lernen (Scholar), d) der Bereitschaft, als Fürsprecher des Patienten einzustehen (Health Advocate) e) einer ethisch ärztlichen Haltung (Professional) sowie f) des Managements (Manager). (2) Der Ausbildungsverantwortliche hat darauf zu achten, dass diese Grundkompetenzen der Turnusärztin/dem Turnusarzt vermittelt werden.
§ 9 KEF und RZ-V 2015 (1) Ausbildungsbücher (sogenannte Logbücher) der Österreichischen Ärztekammer dienen zur detaillierten Dokumentation der einzelnen Ausbildungsschritte durch die Turnusärztin/den Turnusarzt und sind von der Turnusärztin/vom Turnusarzt und der/dem Ausbildungsverantwortlichen zu verwenden. (2) Das Ausbildungsbuch soll der/dem in Ausbildung befindlichen Ärztin/Arzt im Nachweis der erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten unterstützen. (3) Der Inhalt der Ausbildungsbücher ergibt sich aus dem Inhalt der Rasterzeugnisse.
Alles schließen -
Gemäß der ÄAO 2015 ist die Durchführung von Evaluierungsgesprächen in der ärztlichen Ausbildung eng mit der unmittelbaren Ausstellung von Rasterzeugnissen zu den festgelegten Zeitpunkten verbunden. Diese Vorgabe dient, den formalen Rahmen der Leistungsbeurteilung und den Fortschritt der Ausbildungsärzte festzuhalten. Zusätzlich ist es erforderlich den Ausbildungsärzten die Möglichkeit zu geben, den Empfang des Rasterzeugnisses schriftlich zu bestätigen und ihnen Raum für eigene schriftliche Äußerungen auf dem Rasterzeugnis zu gewähren. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass die Ausbildungsärzte aktiv am Bewertungsprozess teilnehmen können und ihre Perspektive berücksichtigt wird.
Darüber hinaus kann neben dem formalen Rasterzeugnis auch ein frei formuliertes Dienstzeugnis ausgestellt werden, auf das die Ausbildungsärzte ebenfalls einen Anspruch haben. Dieses Dienstzeugnis bietet die Möglichkeit, die Leistungen und Kompetenzen der Ausbildungsärzte in einem umfassenderen Kontext darzustellen. Es erlaubt eine individuellere Würdigung der erbrachten Leistungen und des Engagements der Ausbildungsärzte während ihrer Ausbildungszeit. Die Kombination aus Rasterzeugnis und Dienstzeugnis bietet somit eine umfangreiche Dokumentation der Ausbildungsleistung, die sowohl für die weitere berufliche Laufbahn der Ausbildungsärzte als auch für potenzielle Arbeitgeber von großer Bedeutung ist.
Gesetzliche Grundlagen§ 23 Abs 1 ÄAO 2015 Die/der Ausbildungsverantwortliche hat nach Zurücklegung der Mindestausbildungszeiten in den jeweiligen Ausbildungsabschnitten im Sinne des § 3 Z 1, 4 und 6 sowie nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung und, sofern ein Modul die Dauer von mehr als 24 Monaten umfasst, nach der Hälfte der Modulausbildungszeit, unverzüglich die entsprechenden Rasterzeugnisse auszustellen und der Turnusärztin/dem Turnusarzt allenfalls Gelegenheit zu geben, den Empfang der Rasterzeugnisse schriftlich zu bestätigen.
§ 24 ÄAO 2015 Der Turnusärztin/dem Turnusarzt ist Gelegenheit zu geben, auf den Rasterzeugnissen allfällige Äußerungen schriftlich anzumerken.
Alles schließen
-
-
-
-
-
Gemäß § 11 Abs 3 ÄrzteG 1998 ist der Abteilungsleiter der Verantwortliche für die ärztliche Ausbildung. Obgleich § 11 Abs 4 ÄrzteG 1998 die Delegation von Ausbildungsaufgaben an Fachärzte ermöglicht, verbleibt die Gesamtverantwortung stets beim Abteilungsleiter. Die Möglichkeit der Delegation bringt jedoch erhebliche Vorteile mit sich: Ein spezialisierter Facharzt, der die Verantwortung für die Ausbildung übernimmt, bringt seine Expertise und Kenntnisse in Bezug auf die ärztliche Ausbildung ein und ermöglicht es dem Abteilungsleiter, sich auf seine Hauptverantwortlichkeiten zu konzentrieren. Darüber hinaus sorgt ein Ausbildungs-Facharzt für Stabilität in der Ausbildung indem er Einheitlichkeit und Konsistenz sicherstellt. Indem diesem Facharzt gesonderte Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, kann dieser sich intensiver und effizienter auf die Ausbildung konzentrieren. Ein internationaler Vergleich zeigt die globale Prävalenz solcher Delegationsstrukturen, was ihre universelle Anerkennung bekräftigt.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 ÄrzteG 1998 (3) Der Leiter der Ausbildungsstätte ist zur Ausbildung der Ärzte mit dem Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt des jeweiligen Sonderfaches ebenso verpflichtet und dafür verantwortlich wie der Leiter der Abteilung oder Organisationseinheit für die Basisausbildung (Ausbildungsverantwortliche). Eine Ausbildung von Ärzten in einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit, die unter ihrer Leitung stehen, ist unzulässig.
(4) Der Ausbildungsverantwortliche kann von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden.Alles schließen -
In der ärztlichen Ausbildung ist eine strukturierte Rollenverteilung zwischen dem Abteilungsleiter und dem delegierten Facharzt von zentraler Bedeutung. Diese Struktur gewährleistet eine konsistente und effektive Kommunikation mit den Ausbildungsärzten. Indem die Rollen und Zuständigkeiten klar definiert werden, entstehen eindeutige Kommunikationsstrukturen, die sowohl für die Ausbildungsärzte als auch für das leitende Personal nachvollziehbar sind. Zentrale Aufgaben, wie die Einstellung und Einführung von Ausbildungsärzten, die Entwicklung von Ausbildungskonzepten, Planung von Rotationen, Durchführung von Evaluierungsgesprächen, Zeugniserstellung und die laufende Überprüfung der Ausbildungsqualität, müssen klar zugewiesen werden. Es ist ebenso wichtig, dass für jede dieser Aufgaben dem delegierten Facharzt die notwendigen Qualifikationen und Ressourcen bereitgestellt werden.
Alles schließen -
Ausbildungsverantwortliche benötigen Kenntnis über die ausbildungsrechtlichen Rahmenbedingungen (ÄrzteG 1998, ÄAO 2015, KEF und RZ-V 2015 etc.). Die Beachtung dieser Rechtsvorschriften sorgt für Rechtssicherheit. Da sich Rechtsvorschriften ändern können, sollten Ausbildungsverantwortliche sich stets aktuell informieren. Dies liegt auch in der Verantwortung der Träger. Bei rechtlichen Fragestellungen sollten proaktiv die ÖÄK, Ärztekammern in den Ländern oder zuständige Institutionen im Gesundheitssystem kontaktiert werden.
Alles schließen -
Der Ausbildungsverantwortliche in der Medizin spielt eine Schlüsselrolle und sollte vielfältige Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, darunter Erwachsenendidaktik, arbeitsplatzbasierte Lehrmethoden und Feedbackkompetenzen. Zielgerichtete Vorbereitung und ständige Weiterbildung, etwa durch spezialisierte Kurse bei Universitäten oder der österreichischen Akademie der Ärzte GmbH (ÖÄK-CPD Ausbildungskompetenz für den klinischen Alltag), sind essenziell. Neben Didaktik sind Management- und Organisationskompetenzen wichtig für eine reibungslose Organisation der Ausbildung an der Ausbildungsstätte. Trägerinstitutionen sollten klare Anforderungskataloge für Ausbildungsverantwortliche haben, um den Auswahlprozess und die Ausbildungsqualität zu gewährleisten. Die Relevanz von Ausbildungsfähigkeiten sollte auch bei der Auswahl von Abteilungsleitungen berücksichtigt werden, um die Ausbildung als Kernziel zu etablieren.
Gesetzliche Grundlagen§ 5 KEF und RZ-V 2015 (1) In allen Bereichen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hat die/der Ausbildungsverantwortliche darauf zu achten, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt auch in folgenden ärztlichen Rollen gefördert wird: a) der Kommunikation (Communicator), b) der Zusammenarbeit (Collaborator), c) der Fähigkeit für ein lebenslanges Lernen (Scholar), d) der Bereitschaft, als Fürsprecher des Patienten einzustehen (Health Advocate) e) einer ethisch ärztlichen Haltung (Professional) sowie f) des Managements (Manager). (2) Der Ausbildungsverantwortliche hat darauf zu achten, dass diese Grundkompetenzen der Turnusärztin/dem Turnusarzt vermittelt werden.
Alles schließen -
Die Integration eines Ausbildungsverantwortlichen in den klinischen Alltag ist nicht nur organisatorisch von Bedeutung, sondern auch für die Beziehung zwischen Auszubildenden. Wenn der Ausbildungsverantwortliche aktiv am klinischen Geschehen teilnimmt, erlangt er nicht nur eine fundierte Kenntnis der aktuellen Herausforderungen und Bedürfnisse, sondern er wird auch als fester Bestandteil des Teams wahrgenommen. Dies erleichtert die Einbindung von Ausbildungsanforderungen in den Kontext der Einrichtung, da er die Abläufe und Dynamiken der Abteilung kennt. Darüber hinaus stärkt die unmittelbare Präsenz des Ausbildungsverantwortlichen das Vertrauen der Auszubildenden.
Alles schließen -
Ein stetiger Überprüfungsmechanismus sichert die Aktualität und Konformität der Kompetenzen des Ausbildungsverantwortlichen. Der Träger ist für diesen Evaluierungsprozess zuständig und sollte Kriterien, wie interne oder nationale Ausbildungsevaluierungen nutzen. Ein regelmäßiger Überprüfungszeitraum, etwa alle 3-5 Jahre, ermöglicht Feedback und Anpassungen zur stetigen Verbesserung der Ausbildung.
Alles schließen -
Die zentrale Steuerung von Planung, Organisation und Überwachung der ärztlichen Ausbildung durch den Ausbildungsverantwortlichen ist von entscheidender Bedeutung. Eine solche Konsolidierung der Verantwortung gewährleistet, dass alle Aspekte der Ausbildung kohärent und zielgerichtet umgesetzt werden. Zudem erlaubt eine zentrale Steuerung eine effizientere Reaktion auf Feedback und eine schnellere Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen.
Alles schließen -
Ein schriftliches Ausbildungskonzept stellt ein klar definiertes Gerüst für den gesamten Ausbildungsprozess dar. Es ist die zentrale Verantwortung des Ausbildungsbeauftragten, diesen Plan zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren. Durch diesen Plan wird eine strukturierte Vorgehensweise in der ärztlichen Ausbildung gewährleistet. Weiterführende Informationen zum Ausbildungsplan finden Sie im Kapitel "1. Ausbildungskonzept" der Leitlinien.
Gesetzliche Grundlagen§ 9 Abs ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin im jeweiligen Fachgebiet ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich (…)
5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.§ 10 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt eines Sonderfaches ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich (…)
5. über ein schriftliches Ausbildungskonzept verfügt, das unter Darlegung der Ausbildungsstättenstruktur und möglicher Rotationen unter Berücksichtigung von § 10 Abs. 13 die Vermittlung der Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Verordnungen gemäß §§ 24 bis 26 zeitlich und inhaltlich strukturiert festlegt.Alles schließen -
Eine ausgewogene Rotation der Auszubildenden ist entscheidend, um eine konsistente Ausbildung sicherzustellen. Der Ausbildungsverantwortliche trägt maßgeblich zur Qualitätssicherung bei, indem er dafür sorgt, dass alle Auszubildenden notwendige Kenntnisse, Erfahrung und Fertigkeiten aus den verschiedenen Fachbereichen einer Abteilung erlangen. Die Rotation muss sowohl den Bildungszielen der Auszubildenden als auch den Anforderungen der Einrichtung entsprechen. Das Koordinieren dieser Rotation setzt ein tiefgehendes Verständnis der Ausbildungsziele und der Einrichtungsabläufe voraus. Hierbei ist die Zusammenarbeit mit den für die Arbeitszuteilung Zuständigen essenziell.
Weiterführende Informationen zum Thema Rotation sind im Kapitel "Rotationen" der Leitlinien zu finden.
Gesetzliche Grundlagen§ 21 Abs 1 ÄAO 2015 Mit Aufnahme einer allgemeinärztlichen oder der fachärztlichen Ausbildung ist der Turnusärztin/dem Turnusarzt vom Träger der Ausbildungsstätte ein Ausbildungsplan vorzulegen, der die geplante Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zeitlich und inhaltlich strukturiert darstellt. Abweichungen vom erstellten Ausbildungsplan sind nur bei sachlicher Begründung zulässig.
Alles schließen -
Die zentrale Verantwortung des Ausbildungsverantwortlichen besteht darin, sicherzustellen, dass der Ausbildungsarzt die notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten erlangt, wie sie im Rasterzeugnis festgelegt sind. Dies wird in § 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 insofern hervorgehoben, dass der Ausbildungsverantwortliche nicht nur den Erwerb laufend überprüfen, sondern auch beurteilen muss, inwieweit sie dem Ausbildungsarzt entsprechend den Vorgaben der Rasterzeugnisse für die jeweiligen Fachgebiete tatsächlich vermittelt wurden.
Dies bedeutet, dass der Ausbildungsverantwortliche über die bloße Überwachung hinaus eine aktive Beurteilung des Lernfortschritts des Ausbildungsarztes vornehmen muss. Instrumente wie regelmäßige Feedbackgespräche, Logbücher, Operationskataloge und Auswertungen aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) sind dabei hilfreich, um eine objektive Bewertung vorzunehmen.
Der Ausbildungsverantwortliche trägt somit die Verantwortung dafür, dass der Ausbildungsarzt am Ende seiner Ausbildung alle notwendigen Qualifikationen für die Facharztreife erworben hat.
Für weiterführende Informationen wird auf das Kapitel "Leistungsbeurteilung" der Leitlinien verwiesen.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 5 ÄrzteG 1998 Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem Turnusarzt in dem in den Rasterzeugnissen für die jeweiligen Fachgebiete angeführten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. Auf Verlangen des Turnusarztes hat der Ausbildungsverantwortliche nach der Hälfte der Ausbildungszeit der Sonderfach-Grundausbildung oder nach jeder Rotationsabteilung in der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen auszustellen.
Alles schließen -
Regelmäßige Feedback-Gespräche zwischen dem Ausbildungsverantwortlichen und den Auszubildenden sind ein Bestandteil eines umfassenden Feedbacksystems. Diese Gespräche bieten eine wertvolle Gelegenheit für einen direkten Austausch über individuelle Fortschritte, Herausforderungen und Verbesserungspotenziale in der Ausbildung. Sie ergänzen andere Feedback-Mechanismen wie digitale Plattformen und strukturierte Umfragen, indem sie eine persönliche und interaktive Dimension hinzufügen.
Durch diese regelmäßigen Gespräche können Auszubildende ihre Erfahrungen und Anliegen direkt ansprechen, während der Ausbildungsverantwortliche die Möglichkeit hat, gezielte Unterstützung anzubieten und die Ausbildungsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Diese Interaktion trägt dazu bei, das Engagement und die Zufriedenheit der Auszubildenden zu steigern, da sie aktiv in den Verbesserungsprozess eingebunden werden.
Ein strukturierter Ansatz für diese Gespräche, der in einem geschützten Rahmen stattfindet, fördert Vertrauen und Transparenz. Er ermöglicht es, spezifische Themen offen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, was letztlich die Qualität der Ausbildung und das Arbeitsklima verbessert.
Für weiterführende Informationen wird auf das Kapitel "Evaluierung" der Leitlinien verwiesen.
Alles schließen -
Der Ausbildungsverantwortliche hat die zentrale Rolle, Fachärzte zur aktiven Teilnahme an der Ausbildung zu bewegen und sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben in der Ausbildung gewissenhaft ausführen. Dies gilt insbesondere für den Abteilungsvorstand, der in dieser Hinsicht eine Schlüsselposition in der Ausbildungsverantwortung einnimmt.
Die Einbeziehung aller Fachärzte ermöglicht eine umfassende Nutzung des vorhandenen medizinischen Wissens und der fachlichen Kompetenz in der Ausbildungsstätte.
Ein Mentoring-System kann als effektives Instrument dienen, um dieses Potenzial zu aktivieren. Unter Anleitung des Ausbildungsverantwortlichen fördert es den Austausch zwischen erfahrenen Ärzten und den Auszubildenden und trägt so zur Qualität der Ausbildung bei.
Für weiterführende Informationen wird auf das Kapitel "Ausbildungsfachärzte" der Leitlinien verwiesen.
Alles schließen -
Es ist unerlässlich, dass der Ausbildungsverantwortliche in seiner Position sowohl die Unterstützung erhält, die er benötigt, als auch genügend Raum, um effektiv arbeiten zu können. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Skalierung der Zeitressourcen entsprechend der Anzahl der Auszubildenden und die Festlegung eines Mindeststandards von 20% eines Vollzeitäquivalents.
Festgelegte Zeitintervalle, in denen sich der Ausbildungsverantwortliche ausschließlich seinen Aufgaben widmen kann, sind entscheidend. Nur so können notwendige Anpassungen und Optimierungen zeitnah vorgenommen und das Risiko einer Überlastung minimiert werden.
Die Trägerorganisationen sollen dieses Zeitkontingent in ihrer Personalplanung berücksichtigen und zusätzliche Ressourcen bereitstellen. Ein Vergleich mit internationalen Standards, insbesondere mit Regelungen aus dem amerikanischen Ausbildungsprogramm, bestätigt die Bedeutung und den Wert dieses Ansatzes.
Alles schließen -
Eine Vergütung drückt nicht nur die Wertschätzung für die herausragende Rolle des Ausbildungsverantwortlichen aus, sondern fungiert auch als Motivations- und Anerkennungsinstrument.
In einigen Bundesländern ist die Vergütungsstruktur bereits in Karrieremodellen eingebettet, die den Ausbildungsverantwortlichen auf eine Position als leitenden Oberarzt heben, welche naturgemäß mit einer höheren Vergütung verbunden ist. Bundesländer, wie zum Beispiel Oberösterreich, gewähren dem Ausbildungsverantwortlichen eine Funktionszulage.
Unabhängig von der spezifischen Ausgestaltung sollte die Vergütung immer die Komplexität und Verantwortung der Position des Ausbildungsverantwortlichen reflektieren. Sie sollte zudem ein klares Signal für das Engagement der Institution in Richtung Bildungsexzellenz senden und die Erwartungen an die Ausbildungsverantwortlichen klar kommunizieren.
Alles schließen -
Um die geforderten Qualifikationen und Kenntnisse des Ausbildungsverantwortlichen aufrechtzuerhalten, ist es unabdingbar, dass regelmäßig Fortbildungen besucht werden. Dies garantiert, dass er kontinuierlich auf dem neuesten Stand der medizinischen Didaktik bleibt und sich mit aktuellen Lehrmethoden und -ansätzen vertraut macht. Es liegt in der Verantwortung des Trägers, hierfür ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Integration solcher Fortbildungen in die Arbeitszeit zeigt die Wertschätzung und Bedeutung, die der Träger der stetigen Weiterentwicklung und Professionalisierung des Ausbildungsverantwortlichen beimisst.
Alles schließen -
Der Ausbildungsverantwortliche sollte bei Bedarf durch administratives Fachpersonal unterstützt werden. Dieses Fachpersonal kann administrative und organisatorische Aufgaben übernehmen und den Ausbildungsverantwortlichen entlasten.
Alles schließen
-
-
-
Die Einhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses von Ausbildungsärzten zu Fachärzten hat primär den Zweck, eine individuelle Betreuung und eine fokussierte Ausbildung zu gewährleisten. Gemäß den §§ 9 Abs 2 und 10 Abs 4 ÄrzteG 1998 muss für jeden Ausbildungsarzt jeweils mindestens ein Vollzeitäquivalent eines Facharztes des jeweiligen Sonderfaches beschäftigt sein, wobei der Abteilungsleiter mitgezählt werden kann. Nur dadurch kann eine kontinuierliche Anleitung und Aufsicht sichergestellt werden. Es gibt jedoch Ausnahmen wie die Mangelfachregelung des § 37 ÄAO 2015, die für explizit festgelegte Sonderfächer einen anderen Facharztschlüssel vorsieht.
Die aktive Einbindung dieser Fachärzte in den Ausbildungsprozess ist von entscheidender Bedeutung. Sie fungieren nicht nur als Vorbilder, sondern tragen durch direkte Anleitung und Feedback maßgeblich zur Ausbildung der Ausbildungsärzte bei.
Gesetzliche Grundlagen§ 9 Abs 3 ÄrzteG 1998 Die Zahl der in einer Ausbildungsstätte festgesetzten Ausbildungsstellen für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin darf die Zahl der dort beschäftigten Fachärzte nicht überschreiten.
§ 10 Abs 4 ÄrzteG 1998 Für jede Ausbildungsstelle gemäß Abs. 3 ist zur unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der Turnusärztinnen/Turnusärzte mindestens eine Fachärztin/ein Facharzt des betreffenden Sonderfachs in Vollzeitbeschäftigung (oder mehrere teilzeitbeschäftigte Fachärztinnen/Fachärzte im Ausmaß eines Vollzeitäquivalents) zu beschäftigen. Hierzu zählt auch die/der Ausbildungsverantwortliche gemäß § 11 Abs. 3.
Alles schließen -
Ausbildungsärzte sind gemäß § 3 Abs 3 ÄrzteG 1998 ausschließlich zur unselbstständigen Ausübung der Medizin unter der Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte befugt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer ständigen Erreichbarkeit von Ausbildungsfachärzten. Eine solche Erreichbarkeit stellt sicher, dass Auszubildende durchgehend Unterstützung und Anleitung bei ihren klinischen Entscheidungen bekommen. Besonders in dringenden oder unerwarteten Situationen ist der rasche Zugang zu erfahrenen Fachärzten von entscheidender Bedeutung. Ein konstanter Kontakt zwischen Auszubildenden und Fachärzten begünstigt nicht nur das Lernen am Arbeitsplatz, sondern auch die effektive Anwendung des erlernten Wissens in der Praxis.
Gesetzliche Grundlagen§ 3 ÄrzteG 1998 (1) Die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist ausschließlich Ärztinnen/Ärzten für Allgemeinmedizin, approbierten Ärztinnen/Ärzten, Fachärztinnen/Fachärzten und Ärztinnen/Ärzten mit partiellem Berufszugang (§ 5a Abs. 1a) vorbehalten.
(…)
(3) Die in Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin/zum Facharzt befindlichen Ärztinnen/Ärzte (Turnusärztinnen/Turnusärzte) sind lediglich zur unselbstständigen Ausübung der im § 2 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten im Rahmen
1. der gemäß den §§ 6a, 9 und 10 anerkannten Ausbildungsstätten,
2. von Organisationseinheiten an Krankenanstalten, an die organisierte Notarztdienste angebunden sind (§ 40 Abs. 4) sowie
3. der gemäß den §§ 12, 12a und 13 bewilligten Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen und Lehrambulatorien
unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärztinnen/Ärzte berechtigt. Sofern krankenanstaltenrechtliche Organisationsvorschriften keine dauernde Anwesenheit einer Fachärztin/eines Facharztes erfordern, können Turnusärztinnen/Turnusärzte vorübergehend auch ohne Aufsicht einer/eines für die Ausbildung verantwortlichen Fachärztin/Facharztes an einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit für ein Sonderfach tätig werden, sofern sie bereits im Rahmen des Turnus in dem betreffenden Sonderfach hinreichend ausgebildet worden sind, und über die für ein vorübergehendes Tätigwerden ohne Aufsicht entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, wobei ein gleichzeitiges Tätigwerden für mehr als eine Abteilung oder Organisationseinheit unzulässig ist.Alles schließen -
Die Einbindung von Ausbildungsärzten in praktische Tätigkeiten und Entscheidungen ist von zentraler Bedeutung für ihre berufliche Entwicklung. Dies ist besonders relevant für die Ausbildungsfachärzte, mit denen die Ausbildungsärzte im klinischen Alltag direkt zusammenarbeiten.
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die den Ausbildungsärzten übertragen werden, sollten ihrem aktuellen Wissens- und Kompetenzniveau entsprechen. Es ist wichtig, dass diese Anpassung in enger Abstimmung mit den Fachärzten erfolgt, die sie direkt im klinischen Umfeld betreuen.
In solch einer praxisnahen Umgebung können Ausbildungsärzte direkt von der Expertise der Fachärzte profitieren. Sie lernen nicht nur die Theorie, sondern haben auch die Möglichkeit, ihre praktischen Fähigkeiten zu vertiefen. Ziel ist es, dass sie im Laufe ihrer Ausbildung zunehmend Verantwortung übernehmen und sich im klinischen Alltag sicher und kompetent fühlen.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
Alles schließen -
Ein professionelles Ausbildungsumfeld, das den Auszubildenden die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und aktiv nach Unterstützung zu suchen, ist von zentraler Bedeutung. Ein kontinuierlicher, offener Dialog zwischen Ausbildungsfachärzten und Auszubildenden baut Vertrauen auf und intensiviert die professionelle Beziehung.
Indem Auszubildende in einem konstruktiven Umfeld dazu ermutigt werden, ihre Unsicherheiten und Fragen zu äußern, wird das Risiko potenzieller Fehler oder Missverständnisse in der Patientenversorgung reduziert. Dies fördert nicht nur die medizinische Expertise, sondern entwickelt auch die Kommunikationsfähigkeiten der Auszubildenden.
Das Ermutigen von Auszubildenden, aktiv Fragen zu stellen und Unterstützung zu suchen, bereitet sie zudem umfassend auf ihre zukünftige Rolle im klinischen Alltag vor und rüstet sie mit den notwendigen Werkzeugen aus, um aufkommenden Herausforderungen effektiv zu begegnen.
Alles schließen -
Ausbildungsfachärzte tragen eine besondere Verantwortung in der kontinuierlichen Leistungsbeurteilung der Auszubildenden (formative Leistungsbeurteilung). Ein konstruktives und regelmäßiges Feedback ist unerlässlich, um den Auszubildenden ihre Stärken und Entwicklungsbereiche deutlich zu machen. Eine positive Fehlerkultur, welche von den Fachärzten vorgelebt wird, ermutigt Auszubildende dazu, Fehler als Lernchancen zu sehen und sie konstruktiv zu bearbeiten. Durch dieses Vorbild lernen die Auszubildenden, wie wichtig eine offene Kommunikation und Reflexion im medizinischen Alltag ist. Dabei ist eine systematische Dokumentation des Feedbacks und der Fehler essenziell, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Ausbildungsprozess zu bringen.
Für weiterführende Informationen wird auf das Kapitel "Leistungsbeurteilung" der Leitlinien verwiesen
Alles schließen -
Ausbildungsfachärzte verfügen oftmals über tiefgreifendes Fachwissen in ihrem Gebiet. Doch das alleinige Vorhandensein dieses Wissens garantiert nicht die effiziente Weitergabe an Auszubildende. Ein spezialisiertes Fortbildungsprogramm adressiert genau diese Herausforderung, indem es die didaktischen Fähigkeiten der Fachärzte stärkt und die Vermittlung praktischer Fähigkeiten optimiert. Durch solch eine Fortbildung wird nicht nur die Gesamtqualität der Ausbildung verbessert, sondern auch sichergestellt, dass Auszubildende die relevanten Fertigkeiten sicher und gezielt erlernen. Dies ermöglicht es dem Ausbildungsfacharzt, den Lehrprozess individuell auf den Auszubildenden abzustimmen. Zudem kann das Angebot solcher spezialisierten Fortbildungen die Bereitschaft und das Engagement von Fachärzten in der Ausbildungsarbeit steigern.
Alles schließen -
Ein aktives Mentoring-System für Ausbildungsfachärzte zielt darauf ab, eine intensivere und individuelle Begleitung der Auszubildenden sicherzustellen. Im Zentrum dieses Systems steht der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, die eine offene und konstruktive Kommunikation zwischen Mentor und Mentee fördert. In einem solchen Umfeld können Auszubildende gezieltes Feedback erhalten, das es ihnen ermöglicht, ihre Fertigkeiten laufend zu schärfen. Für eine erfolgreiche Implementierung eines Mentoring-Systems müssen klare Richtlinien festgelegt werden, insbesondere hinsichtlich der Rollen von Mentor und Mentee sowie den zu erwartenden Zielen. Die Dokumentation des Mentoring-Verhältnisses gewährleistet Transparenz und ermöglicht eine nachhaltige Qualitätskontrolle. Dabei kann das Mentoring sowohl auf die fachliche Weiterentwicklung als auch auf die Persönlichkeitsentwicklung des Auszubildenden abzielen.
Alles schließen
-
-
-
-
-
Durch die frühzeitige Information der neuen Ausbildungsärzte über die Inhalte der Rasterzeugnisse und die damit verbundenen Lernziele wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben des ÄrzteG 1998 und der ÄAO 2015 eingehalten werden. Insbesondere § 20 ÄAO 2015 schreibt vor, dass die Rasterzeugnisformulare den Turnusärzten zu Beginn der Ausbildung in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht werden müssen. Dies kann sowohl digital als auch analog erfolgen und gegebenenfalls in Verbindung mit der Kommunikation des Ausbildungskonzepts stehen. Die frühzeitige Kommunikation der Ausbildungsinhalte und -ziele schafft Klarheit über die Erwartungen an die Ausbildungsärzte und fördert deren Eigenverantwortung.
Gesetzliche Grundlagen§ 20 ÄAO 2015 Die Rasterzeugnisformulare sind der Turnusärztin/dem Turnusarzt von der/dem Ausbildungsverantwortlichen am Beginn der Ausbildung in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen.
§ 21 Abs 1 ÄAO 2015 Mit Aufnahme einer allgemeinärztlichen oder der fachärztlichen Ausbildung ist der Turnusärztin/dem Turnusarzt vom Träger der Ausbildungsstätte ein Ausbildungsplan vorzulegen, der die geplante Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungsstätten zeitlich und inhaltlich strukturiert darstellt. Abweichungen vom erstellten Ausbildungsplan sind nur bei sachlicher Begründung zulässig.
Alles schließen -
Ein strukturiertes Onboarding-Programm ist essenziell für den erfolgreichen Start neuer Ausbildungsärzte in der Klinik. Es sollte eine umfassende Einführung in die wichtigsten Bereiche der Krankenanstalt bieten und sich auf die ersten Wochen konzentrieren.
Zentrale Bestandteile sind die Vermittlung klinikspezifischer Abläufe und Prozesse, die Einführung in genutzte IT-Systeme und Software sowie arbeitsplatzrelevante Schulungen zu Themen wie Hygiene, Datenschutz oder spezielle Geräte.
Ebenso wichtig ist die Aufklärung der Ausbildungsärzte über ihre Rechte und berufsrechtliche Pflichten, insbesondere im Umgang mit Patienten. Dazu gehören Aspekte wie Sorgfaltspflicht, Verschwiegenheitspflicht und Anzeige- und Meldepflichten.
Das Onboarding-Programm sollte flexibel gestaltet und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Digitale Formate wie Intranet-Seiten oder E-Learning-Module können ergänzend eingesetzt werden.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 10 ÄAO 2015 Die Ausbildung hat begleitende theoretische Unterweisungen zu enthalten und Kenntnisse in den für die Ausübung des ärztlichen Berufes einschlägigen Rechtsvorschriften, in der Dokumentation und in der Qualitätssicherung zu vermitteln.
Alles schließen -
Eine strukturierte Einarbeitungszeit trägt dazu bei, dass sich Ausbildungsärzte schnell in neuen Tätigkeitsbereichen zurechtfinden, effektiv arbeiten und sich gut ins Team integrieren können. Es obliegt der Verantwortung der Ausbildungsstätte, adäquate Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen.
Neben dem Ausbildungsverantwortlichen sollten auch die bereichsverantwortlichen Fachärzte Konzepte und Richtlinien für angemessene Einarbeitungszeiten entwickeln und bereitstellen, die genau auf die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten des jeweiligen Arbeitsplatzes abgestimmt sind.Die Einarbeitungszeiten sind für die verschiedenen Arbeitsplätze festzulegen und zu kommunizieren, wobei die Dauer je nach Komplexität des Bereichs variieren kann. Es sollte vermieden werden, dass Ausbildungsärzte aufgrund von Personalmangel auf Arbeitsplätzen eingesetzt werden, für die keine ausreichende Einarbeitung stattgefunden hat.
Peer-to-Peer-Einschulungen, bei denen erfahrene Ärzte in Ausbildung ihre neuen Kollegen anleiten, können eine effektive Methode darstellen, um den Einarbeitungsprozess zu unterstützen.
Zielgerichtete Schulungen und Einweisungen, die speziell auf die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes zugeschnitten sind, können sowohl in digitaler als auch in physischer Form angeboten werden. Der Einsatz von Checklisten kann dabei unterstützen, alle relevanten Aspekte zu erfassen und den Fortschritt der Einarbeitung zu dokumentieren.
Gesetzliche Grundlagen§ 3 ÄrzteG 1998 (1) Die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist ausschließlich Ärztinnen/Ärzten für Allgemeinmedizin, approbierten Ärztinnen/Ärzten, Fachärztinnen/Fachärzten und Ärztinnen/Ärzten mit partiellem Berufszugang (§ 5a Abs. 1a) vorbehalten.
(3) Die in Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin/zum Facharzt befindlichen Ärztinnen/Ärzte (Turnusärztinnen/Turnusärzte) sind lediglich zur unselbstständigen Ausübung der im § 2 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten im Rahmen
1. der gemäß den §§ 6a, 9 und 10 anerkannten Ausbildungsstätten,
2. von Organisationseinheiten an Krankenanstalten, an die organisierte Notarztdienste angebunden sind (§ 40 Abs. 4) sowie
3. der gemäß den §§ 12, 12a und 13 bewilligten Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen und Lehrambulatorien
unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärztinnen/Ärzte berechtigt. Sofern krankenanstaltenrechtliche Organisationsvorschriften keine dauernde Anwesenheit einer Fachärztin/eines Facharztes erfordern, können Turnusärztinnen/Turnusärzte vorübergehend auch ohne Aufsicht einer/eines für die Ausbildung verantwortlichen Fachärztin/Facharztes an einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit für ein Sonderfach tätig werden, sofern sie bereits im Rahmen des Turnus in dem betreffenden Sonderfach hinreichend ausgebildet worden sind, und über die für ein vorübergehendes Tätigwerden ohne Aufsicht entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, wobei ein gleichzeitiges Tätigwerden für mehr als eine Abteilung oder Organisationseinheit unzulässig ist.Alles schließen -
Die geräte- und anwendungsspezifische Einweisung von Ausbildungsärzten vor der Anwendung von Medizinprodukten dient in erster Linie der Sicherstellung einer korrekten und sicheren Handhabung. Durch die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten sollen Fehlbedienungen und daraus resultierende Risiken für Patienten minimiert werden.
Gleichzeitig erfüllt die Ausbildungsstätte damit die gesetzlichen Anforderungen des österreichischen Medizinproduktegesetzes. § 52 Abs 1 MPG schreibt vor, dass Medizinprodukte nur von Personen angewendet werden dürfen, die zuvor eine sachgerechte Einweisung erhalten und auf spezifische Gefahren hingewiesen wurden. Die Einweisungen sind zu dokumentieren (§ 52 Abs 3 MPG) und müssen durch geeignete Personen mit entsprechender Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung erfolgen.
Um die Umsetzung in der Praxis zu erleichtern, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen beispielsweise die Einführung von Gerätepässen, Checklisten für relevante Medizinprodukte oder die Benennung von Geräteverantwortlichen.
Nicht zuletzt dient die Maßnahme auch dem Schutz der Ausbildungsärzte selbst. Durch die nachweisliche Teilnahme an den Einweisungen können sie belegen, dass sie für die Anwendung der Medizinprodukte qualifiziert sind und haftungsrechtliche Konsequenzen bei Fehlbedienungen vermeiden.
Gesetzliche Grundlagen§ 52 MPG 2021 (1) Medizinprodukte gemäß einer Verordnung nach § 50 Abs. 1 dürfen nur von Personen angewendet werden, die am Medizinprodukt oder an einem Medizinprodukt dieses Typs unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung sowie der beigefügten sicherheitsbezogenen Informationen in die sachgerechte Handhabung eingewiesen und auch auf besondere anwendungs- und medizinproduktespezifische Gefahren hingewiesen worden sind. Es dürfen nur solche Personen einweisen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und praktischen Erfahrungen für die Einweisung in die Handhabung dieser Medizinprodukte geeignet sind. Erforderlichenfalls hat der Betreiber wiederkehrende Schulungen vorzusehen.
(2) Werden Medizinprodukte gemäß einer Verordnung nach § 50 Abs. 1 mit Zubehör, Software oder weiteren Medizinprodukten zu Gerätekombinationen erweitert, hat sich die Einweisung des Personals auf die jeweiligen Kombinationen und deren Besonderheiten zu erstrecken.
(3) Einweisungen gemäß Abs. 1 und 2 sind zu dokumentieren.Alles schließen -
Gemäß § 3 Abs 2 ÄrzteG 1998 sind Ausbildungsärzte grundsätzlich nur zur unselbstständigen Ausübung der Medizin unter Anleitung und Aufsicht befugt. Ein vorübergehendes Tätigwerden ohne direkte Aufsicht, wie es im Nachtdienst oft der Fall ist, setzt voraus, dass die Ausbildungsärzte bereits hinreichend in dem betreffenden Sonderfach ausgebildet wurden und über die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen.
Um dies sicherzustellen, sollten die Ausbildungsstätten gewisse Voraussetzungen definieren, die vor der Übernahme von Nachtdiensten erfüllt sein müssen. Dazu zählen beispielsweise eine festgelegte Einarbeitungszeit in der jeweiligen Abteilung, der Nachweis notfallmedizinischer Schulungen wie Reanimationstrainings und abteilungsspezifischer Fortbildungen zu Themen wie Transfusionsmedizin oder Schmerztherapie. Auch Vorerfahrungen in der eigenständigen Patientenversorgung unter Aufsicht sowie Kenntnisse über Krankenhausstrukturen und Eskalationswege sind wichtige Kriterien.
Die festgelegten Kriterien sollten transparent an die Ausbildungsärzte und die ausbildenden Fachärzte kommuniziert werden. So wissen alle Beteiligten, welche Anforderungen erfüllt sein müssen und können die Einsatzplanung entsprechend gestalten.
Letztlich liegt die Entscheidung, ob ein Ausbildungsarzt im Nachtdienst tätig wird, beim zuständigen Ausbildungsverantwortlichen oder Abteilungsleiter, der die individuellen Fähigkeiten und die persönliche Eignung des Arztes einschätzen muss.Gesetzliche Grundlagen§ 3 ÄrzteG 1998 (1) Die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist ausschließlich Ärztinnen/Ärzten für Allgemeinmedizin, approbierten Ärztinnen/Ärzten, Fachärztinnen/Fachärzten und Ärztinnen/Ärzten mit partiellem Berufszugang (§ 5a Abs. 1a) vorbehalten.
(3) Die in Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin/zum Facharzt befindlichen Ärztinnen/Ärzte (Turnusärztinnen/Turnusärzte) sind lediglich zur unselbstständigen Ausübung der im § 2 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten im Rahmen
1. der gemäß den §§ 6a, 9 und 10 anerkannten Ausbildungsstätten,
2. von Organisationseinheiten an Krankenanstalten, an die organisierte Notarztdienste angebunden sind (§ 40 Abs. 4) sowie
3. der gemäß den §§ 12, 12a und 13 bewilligten Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen und Lehrambulatorien
unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärztinnen/Ärzte berechtigt. Sofern krankenanstaltenrechtliche Organisationsvorschriften keine dauernde Anwesenheit einer Fachärztin/eines Facharztes erfordern, können Turnusärztinnen/Turnusärzte vorübergehend auch ohne Aufsicht einer/eines für die Ausbildung verantwortlichen Fachärztin/Facharztes an einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit für ein Sonderfach tätig werden, sofern sie bereits im Rahmen des Turnus in dem betreffenden Sonderfach hinreichend ausgebildet worden sind, und über die für ein vorübergehendes Tätigwerden ohne Aufsicht entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen,§ 8 Abs 1 ÄAO 2015 Sofern fachlich erforderlich und dienst- bzw. arbeitsrechtlich zulässig, ist von einer Turnusärztin/einem Turnusarzt zumindest ein fachbezogener Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsdienst pro Monat in einem Durchrechnungszeitraum von neun Monaten zu absolvieren.
Alles schließen -
Der Träger der Ausbildungsstätte ist verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Eintritt eines aus- oder weiterbildungsbezogenen Meldegrundes, wie Beginn, Ausmaßänderung, Wechsel, Unterbrechung oder Abschluss, eine Meldung im Ausbildungsstellenverzeichnis abzugeben. Diese digitale Applikation wird von der Österreichischen Ärztekammer zur Verfügung gestellt und dient der Nachvollziehbarkeit der zeitlichen Begrenzung von Ausbildungsstellen. Entsprechend dem Ärztegesetz muss die Meldung schriftlich durch Dateneingabe in diese Applikation erfolgen. Die Applikation ermöglicht es, die Ausbildungszeiten für die Anrechnung transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Eine korrekte und fristgerechte Meldung ist entscheidend, da absolvierten Zeiten nur dann für die Ausbildung angerechnet werden können, wenn die Meldung im Ausbildungsstellenverzeichnis ordnungsgemäß erfolgt ist. Für die Ausbildungsärzte bietet die Applikation die Möglichkeit, ihren aktuellen Meldestatus über meindfp.at online einzusehen. Diese Anforderungen gewährleisten, dass die Verwaltung der Ausbildungsplätze effizient und gesetzeskonform erfolgt.
Gesetzliche Grundlagen§ 13a Abs 3 ÄrzteG 1998 Die entsprechenden Daten gemäß Abs. 2 Z 6 bis 12 betreffend Ärztinnen/Ärzte in Aus- oder Weiterbildung sind von
1. Trägern der Ausbildungsstätten gemäß §§ 6a, 9, 10,
2. Trägern der Spezialisierungsstätten gemäß § 11a Abs. 2,
3. Lehrpraxisinhaberinnen/Lehrpraxisinhaber gemäß § 12,
4. Gesellschafterinnen/Gesellschaftern von Lehrgruppenpraxen gemäß § 12a sowie
5. Leiterinnen/Leitern der Lehrambulatorien gemäß § 13
unter Angabe der Daten gemäß Abs. 2 Z 3 bis 5, soweit vorhanden auch der Daten gemäß Abs. 2 Z 1 oder 2, der Österreichischen Ärztekammer innerhalb eines Monats ab Eintritt des aus- oder weiterbildungsbezogenen Meldegrundes (Beginn, Ausmaßänderung, Wechsel, Unterbrechung oder Abschluss) schriftlich durch Dateneingabe in die zur Verfügung gestellte Applikation gemäß Abs. 1 zu melden. Gleiches gilt für Einrichtungen gemäß § 235 Abs. 4. Lehrpraxisinhaberinnen/Lehrpraxisinhaber sowie Gesellschafterinnen/Gesellschaftern von Lehrgruppenpraxen dürfen die Meldungen auch in sonstiger Weise schriftlich an die Österreichische Ärztekammer vornehmen.Alles schließen
-
-
-
Die postpromotionelle ärztliche Ausbildung zeichnet sich durch ihre besondere Einbettung in den klinischen Alltag aus. Die Lernerfahrung der angehenden Ärzte findet während ihrer Arbeit im Krankenhaus und unmittelbar bei der Patientenversorgung statt. Ein geschütztes Umfeld sollte es den Ausbildungsärzten ermöglichen, schrittweise an die eigenständige ärztliche Tätigkeit herangeführt zu werden, ohne dabei über- oder unterfordert zu werden.
Für die Ausbildungsstätten bedeutet dies, die übertragenen Aufgaben sorgfältig auf das individuelle Wissens- und Erfahrungsniveau der Ausbildungsärzte abzustimmen. Die Zuteilung der Aufgaben orientiert sich dabei an den aufeinander aufbauenden Ausbildungsabschnitten - Basisausbildung, Grundausbildung und Schwerpunktausbildung - die mit einer kontinuierlichen Steigerung des Kompetenzniveaus einhergehen sollte. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Ausbildungsstätten den Entwicklungsprozess der angehenden Ärzte im Blick haben und ihnen den Raum für individuelles Wachstum und Lernen zugestehen.
Eine bedarfsgerechte Gestaltung der klinischen Lernmöglichkeiten erfordert eine enge Abstimmung zwischen den Anforderungen der Patientenversorgung und den individuellen Ausbildungszielen. Zu Beginn der Ausbildung ist eine engmaschige Supervision und Unterstützung notwendig, um den Ausbildungsärzten Sicherheit zu geben und sie schrittweise an mehr Verantwortung heranzuführen. Mit zunehmender Erfahrung sollen die Ausbildungsärzte dann selbstständiger arbeiten und komplexere Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig liegt es auch in der Verantwortung der Ausbildungsärzte selbst, aktiv an der Erweiterung ihrer Kompetenzen zu arbeiten. Sie sollten sich engagiert in den klinischen Alltag einbringen, sich gründlich auf ihre Tätigkeitsfelder vorbereiten und proaktiv Lernmöglichkeiten wahrnehmen. Durch Eigeninitiative, Reflexion und die Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen, können die angehenden Ärzte ihre fachlichen und persönlichen Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Eine präzise und vollständige Dokumentation ist entscheidend für eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung, da sie sicherstellt, dass alle relevanten Informationen jederzeit für die an der Behandlung beteiligten Personen verfügbar sind. Zudem dient sie als Nachweis für durchgeführte Maßnahmen und getroffene Entscheidungen, was auch für die Rechtssicherheit von großer Bedeutung ist.
Die Ausbildungsärzte benötigen eine Anleitung, wie sie Patienteninformationen strukturiert und vollständig erfassen können.
Zur Unterstützung sollten Hilfsmittel wie Vorlagen, Leitfäden, IT-Systeme und standardisierte Formulare bereitgestellt werden, die eine einheitliche und effiziente Dokumentation erleichtern. Feedback durch erfahrene Ärzte sowie Schulungen können notwendig sein, um die Dokumentationsqualität der Ausbildungsärzte kontinuierlich zu verbessern.
Die Verfügbarkeit von Assistenzpersonal, die die Ausbildungsärzte bei administrativen Aufgaben der Dokumentation unterstützt, kann ebenfalls dazu beitragen, die Qualität der Dokumentation zu verbessern und den Ärzten mehr Zeit für die Patientenversorgung zu geben.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Die Ausbildungsstätte trägt die Verantwortung, die Ausbildungsärzte schrittweise und strukturiert an die selbstständige Durchführung diagnostischer Verfahren heranzuführen. Dabei muss sie sich an definierten Ausbildungszielen und dem jeweiligen Kompetenzniveau der Ärzte orientieren.
In einem ersten Schritt gilt es, den Ausbildungsärzten ein fundiertes Wissen über Indikationen, Kontraindikationen und Limitationen der verschiedenen Verfahren zu vermitteln. Sie müssen lernen, für spezifische klinische Fragestellungen die geeignete diagnostische Methode auszuwählen und Indikation sowie Risiken gegenüber Patienten und anderen Behandlern verständlich zu kommunizieren.
Mit zunehmender Erfahrung rückt die Interpretation der Befunde in den Mittelpunkt. Die Ausbildungsärzte müssen in der korrekten Durchführung und Befundung der Verfahren geschult werden. Sie sollten lernen, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, im klinischen Kontext zu interpretieren und daraus die richtigen Schlüsse für die weitere Diagnostik und Therapie zu ziehen. Feedback durch erfahrene Ärzte ist in dieser Phase von Bedeutung.
Schließlich gilt es, die Ausbildungsärzte an die selbstständige Durchführung diagnostischer Verfahren heranzuführen. Unter anfänglich enger Supervision sollten sie schrittweise mehr Verantwortung übernehmen. Neben der technischen Durchführung geht es auch um die Entwicklung von Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit. Die Ausbildungsärzte müssen lernen, eigenständig Indikationen zu stellen, Befunde zu erheben und zu interpretieren sowie die Ergebnisse mit Patienten und anderen Behandlern zu kommunizieren.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Die didaktische und schrittweise Heranführung der Ausbildungsärzte an manuelle Fertigkeiten und Operationen ermöglicht es den Ausbildungsärzten, sich die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, um sicher und effektiv sowohl operative Eingriffe als auch manuelle Techniken durchzuführen.
Zu Beginn erwerben die Ausbildungsärzte Grundkenntnisse, die die Basis für jegliche manuelle und operative Tätigkeit bilden. Dazu zählt das Wissen über die erforderlichen Ressourcen, die Indikationen sowie das Management möglicher Komplikationen.
Der nächste Schritt umfasst die Beobachtung von Eingriffen und manuellen Techniken, um ein Verständnis für den Ablauf und die spezifischen Techniken zu entwickeln. Anschließend assistieren die Ausbildungsärzte unter der Anleitung erfahrener Kollegen. Hierbei sammeln sie erste praktische Erfahrungen und lernen, wie sie im Team mitarbeiten können.
Mit zunehmender Erfahrung übernehmen die Ausbildungsärzte schrittweise einzelne Schritte bei Operationen und die Anwendung manueller Techniken. Dieser Prozess ermöglicht es ihnen, ihre Fertigkeiten unter realen Bedingungen zu üben und zu verfeinern. Die eigenständige Durchführung von Operationen und manuellen Techniken unter Supervision stellt den letzten Schritt dar. Hierbei agieren die Ausbildungsärzte selbstständig, während erfahrene Kollegen als Sicherheitsnetz fungieren.
Nach jeder praktischen Anwendung ist es wichtig, dass die Ausbildungsärzte Feedback von ihren Anleitern erhalten können. Dieses Feedback ist entscheidend für den Lernprozess, da es den Ausbildungsärzten ermöglicht, ihre Leistung zu reflektieren und gezielt an ihren Schwächen zu arbeiten.
Die Förderung des interprofessionellen Lernens im Team, insbesondere im OP, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die Ausbildungsärzte sollen lernen, effektiv mit den verschiedenen Mitgliedern des Teams zusammenzuarbeiten, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.
Die Einführung von "Entrustable Professional Activities" (EPAs) kann dabei helfen, den Fortschritt der Ausbildungsärzte zu messen und zu dokumentieren. EPAs sind professionelle Tätigkeiten, die Ausbildungsärzte eigenständig durchführen dürfen, sobald sie das erforderliche Kompetenzniveau erreicht haben. Sie bieten eine strukturierte Möglichkeit, die Entwicklung der Ausbildungsärzte zu überwachen und zu fördern.
Gesetzliche Grundlagen§ 4 Abs 3 KEF und RZ-V 2015 Sofern in den Anlagen Fertigkeiten für operative Eingriffe angeführt sind, sind Fertigkeiten in der selbstständigen Durchführung der Operation zu erwerben. Bei Operationen höheren Schwierigkeitsgrades können 20 von 100 der angegebenen Richtzahlen auch als erste Assistenz erfolgen.
§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Die Ausbildungsstätte sollte den Ausbildungsärzten klar vermitteln, welche Rolle sie während der Visiten einnehmen sollen und welche Lernziele damit verbunden sind. Dabei ist es wichtig, die Einbindung je nach Kompetenzniveau zu gestalten und den Ausbildungsärzten die Möglichkeit zu geben, sich unter entsprechender Supervision weiterzuentwickeln.
Im Laufe ihrer Ausbildung sollten die Ausbildungsärzte zunehmend Verantwortung während der Visiten übernehmen und Visitentätigkeiten unter Supervision durchführen. Dies fördert das praxisnahe Lernen und die klinische Entscheidungsfindung. Gleichzeitig erhalten die Ausbildungsärzte die Gelegenheit, den strukturierten Ablauf einer Visite zu erlernen.
Ein wichtiger Aspekt der Visite ist die Kommunikation und Interaktion mit den Patienten. Die Ausbildungsärzte sollten lernen, effektiv mit Patienten zu kommunizieren, ihre Anliegen und Bedürfnisse zu verstehen und empathisch darauf einzugehen. Durch die Beobachtung erfahrener Ärzte und die eigene Durchführung von Patientengesprächen unter Supervision können die Ausbildungsärzte ihre kommunikativen Fähigkeiten schrittweise verbessern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das zeitnahe Feedback durch erfahrene Ärzte. Kurze Besprechungen vor und nach den Visiten geben den Ausbildungsärzten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Unklarheiten zu klären und Rückmeldungen zu ihrer Leistung zu erhalten.
Neben den regulären Visiten können spezielle Lehrvisiten eingeplant werden, bei denen der Fokus verstärkt auf der Ausbildung liegt. Hier können komplexe Fälle detailliert besprochen, Differentialdiagnosen diskutiert und Behandlungsoptionen erörtert werden. Diese Lehrvisiten bieten eine strukturierte Lernumgebung, in der die Ausbildungsärzte ihr Wissen vertiefen und klinische Reasoning-Fähigkeiten entwickeln können.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Die Betreuung von Patienten in der Ambulanz ermöglicht Ausbildungsärzten den Erwerb spezifischer Kompetenzen und ergänzt die Erfahrungen aus dem stationären Bereich. Durch die Tätigkeit in diesem Setting erweitern die angehenden Fachärzte ihr Verständnis für den gesamten Behandlungspfad von Patienten, der sowohl den ambulanten als auch den stationären Sektor umfasst. Sie lernen, die Besonderheiten der ambulanten Versorgung zu berücksichtigen und die Langzeitbetreuung und Nachsorge von Patienten zu gestalten.
Sie lernen, unter den spezifischen Bedingungen der Ambulanz effizient zu arbeiten und die oft begrenzten zeitlichen Ressourcen optimal zu nutzen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation mit niedergelassenen Ärzten und anderen ambulanten Einrichtungen. Die Ausbildungsärzte lernen, wie sie effektiv mit diesen Partnern zusammenarbeiten und eine kontinuierliche Versorgung der Patienten über die Sektorengrenzen hinweg gewährleisten können.
Voraussetzung für die Betreuung von Patienten in der Ambulanz durch Ausbildungsärzte ist eine angemessene Supervision durch erfahrene Ärzte. Diese stehen den Ausbildungsärzten als Ansprechpartner zur Verfügung, geben Feedback und unterstützen sie bei komplexen Fragestellungen. Durch die enge Begleitung wird sichergestellt, dass Ausbildungsärzte schrittweise an die eigenständige Tätigkeit herangeführt werden.
Gesetzliche Grundlagen§ 4 Abs 7 KEF und RZ-V 2015 Die Ausbildungsinhalte sind, sofern in den Anlagen nichts anderes angeführt ist, je nach fachspezifischer Möglichkeit an ambulanten und/oder stationären Patientinnen und Patienten zu vermitteln.
§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Die strukturierte Patientenübergabe und Fallbesprechung sind essenzielle Fähigkeiten, die Ausbildungsärzte erlernen müssen. Sie sollen relevante Informationen identifizieren und diese klar und präzise kommunizieren können. Zudem ist die Entwicklung der Kompetenz zur kritischen Analyse und Bewertung medizinischer Fälle wichtig, einschließlich der Interpretation von Informationen und dem Erkennen und Lösen von Problemen.
Es ist entscheidend, dass die Schulung zur Patientenübergabe klar strukturiert wird und sowohl die Inhalte präzise vermittelt als auch praktische Empfehlungen zur Durchführung zu setzender Maßnahmen gegeben werden. Ausbildungsärzte aller Stufen sollten verpflichtend an regelmäßigen Fallbesprechungen und Präsentationen teilnehmen und aktiv beitragen.
Strukturierte Übergaben und Fallbesprechungen sollten fest in den Ausbildungsplänen verankert sein. Regelmäßige Trainings, kontinuierliches Feedback und die enge Begleitung durch erfahrene Ärzte sollten an der Ausbildungsstätte gewährleistet werden.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen -
Die Beteiligung von Ausbildungsärzten an interdisziplinären Konferenzen wie Tumorboards, Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen sowie Radiologiebesprechungen ist ein zentraler Aspekt ihrer professionellen Entwicklung. Diese Veranstaltungen bieten den angehenden Ärzten nicht nur die Möglichkeit, ihr medizinisches Wissen zu vertiefen, sondern auch von der Erfahrung und Expertise erfahrener Fachärzte unterschiedlicher Fachbereiche zu profitieren und wertvolle Praxiserfahrungen in der Anwendung von evidenzbasierter Medizin zu sammeln.
Um die Bedeutung dieser Konferenzen zu betonen, sollte ihre Teilnahme fest im Ausbildungsplan verankert werden. Die Ausbildungsstätten sollten zudem Strukturen schaffen, die eine effektive Vorbereitung und Nachbereitung der Konferenzen ermöglichen und die Ausbildungsärzte für diese Zeit von anderen Aufgaben entbinden.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 11 ÄAO 2015 Die Turnusärztinnen/Turnusärzte sind zur persönlichen Mitarbeit heranzuziehen und haben entsprechend ihrem Ausbildungsstand Mitverantwortung zu übernehmen.
§ 6 Abs 1 ÄAO 2015 Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
§ 10 Abs 1 ÄAO 2015 Ziel der allgemeinärztlichen Ausbildung ist die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Allgemeinmedizin durch den geregelten Erwerb und Nachweis von für die gewissenhafte Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in den gemäß der Anlage 1 angeführten Fachgebieten.
§ 16 ÄAO 2015 Ziel der fachärztlichen Ausbildung ist, soweit dies für das jeweilige Sonderfach in Betracht kommt, die Befähigung zur selbständigen Ausübung der Medizin im Bereich eines Sonderfaches gemäß § 15 zur gewissenhaften fachärztlichen Betreuung von Patientinnen/Patienten aller Altersstufen durch den geregelten Erwerb und Nachweis von notwendigen fachspezifischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, sofern in den Anlagen nicht anderes bestimmt ist.
Alles schließen
-
-
-
Die Empfehlung zielt darauf ab, eine klare Abgrenzung zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen Tätigkeiten zu schaffen. Insbesondere Ärzte am Beginn ihrer Karriere und in der Ausbildung sollen davor geschützt werden, dass ihre Ausbildung zugunsten von nicht-ärztlichen Tätigkeiten vernachlässigt wird.
Das Tätigkeitsprofil für Turnusärzte der Österreichischen Ärztekammer konkretisiert, welche Aufgaben als ärztliche Tätigkeiten zu verstehen sind und in das Aufgabenprofil von Ausbildungsärzten fallen. Dazu zählen beispielsweise die Anamnese, körperliche Untersuchung, Indikationsstellung und Therapie unter Anleitung und Aufsicht. Nicht-ärztliche Tätigkeiten, wie pflegerische, administrative und organisatorische Aufgaben sollen hingegen von geeigneten Krankenhauspersonal durchgeführt werden.
Gemäß § 9 Abs 2 Z 4 ÄrzteG 1998 muss die Ausbildungsstätte über einen Pflegedienst verfügen, der die Durchführung jener Tätigkeiten gewährleistet, die in § 15 Abs 5 GuKG ausdrücklich bezeichnet sind. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, die in den eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege fallen. Ausbildungsärzte sollen demnach nicht regelhaft für diese Tätigkeiten eingesetzt werden. Die Ausbildungsstätte ist verpflichtet sicherzustellen, dass ausreichend Pflegepersonal vorhanden ist.
Während die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung in einem interprofessionellen Team essenziell ist, sollte es dennoch zu keiner institutionalisierten Verschiebung von nicht-ärztlichen Tätigkeiten auf Ausbildungsärzte kommen. Eine klare Aufgabenteilung dient als Rahmen für die Zusammenarbeit, lässt aber gleichzeitig Raum für situationsbedingte Flexibilität und kollegiale Unterstützung.
Eine regelmäßige Überprüfung der zugeteilten Aufgaben hinsichtlich ihrer Relevanz für die Ausbildungsziele ist daher unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Ausbildungsärzte die im Rasterzeugnis definierten Kompetenzen effektiv erwerben können.
Gesetzliche Grundlagen§ 9 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin im jeweiligen Fachgebiet ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich (…)
4. sofern pflegerische Leistungen zu erbringen sind, über einen Pflegedienst verfügt, der die Durchführung jener Tätigkeiten, die in § 15 Abs. 5 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 185/2013, ausdrücklich bezeichnet sind, gewährleistet und Turnusärztinnen/Turnusärzte für diese Tätigkeiten insbesondere im Zeitraum der neunmonatigen Basisausbildung herangezogen werden können, wenn dies für den Erwerb der für die Erreichung des Ausbildungsziels erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten notwendig ist,§ 10 Abs 2 ÄrzteG 1998 Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt eines Sonderfaches ist gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Ausbildungsstätte nachweislich (…)
4. sofern pflegerische Leistungen zu erbringen sind, über einen Pflegedienst verfügt, der die Durchführung jener Tätigkeiten, die in § 15 Abs. 5 GuKG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 185/2013 ausdrücklich bezeichnet sind, gewährleistet und Turnusärztinnen/Turnusärzte für diese Tätigkeiten insbesondere im Zeitraum der neunmonatigen Basisausbildung herangezogen werden können, wenn dies für den Erwerb der für die Erreichung des Ausbildungsziels erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten notwendig ist,Alles schließen -
Die klare Aufgabenteilung zwischen ärztlichem, pflegerischem und medizinisch-administrativem Personal ist insbesondere für Ausbildungsärzte von großer Bedeutung. Gerade am Beginn ihrer Karriere benötigen sie ein klares Verständnis der eigenen Rolle und Verantwortlichkeiten sowie der Schnittstellen zu anderen Berufsgruppen. Unklarheiten in der Aufgabenteilung können zu Unsicherheiten, Fehlern und Konflikten führen.
Eine schriftliche Fixierung der Aufgabenteilung, insbesondere an neuralgischen Schnittstellen, schafft Transparenz und Verbindlichkeit für alle Beteiligten. Sie dient als Referenz im Arbeitsalltag und hilft Ausbildungsärzten, ihren Platz im interprofessionellen Gefüge zu finden. Beispiele für solche schriftlichen Vereinbarungen sind Matrizen oder multiprofessionelle Prozessbeschreibungen, die die Rollen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Professionen definieren, oder konkrete Tätigkeitsbeschreibungen für spezielle Bereiche oder Situationen.
Die Ausarbeitung und Umsetzung einer klaren Aufgabenteilung liegt in der Verantwortung der Führungskräfte. Sie müssen sicherstellen, dass die Rollen und Verantwortlichkeiten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und berufsspezifischen Kompetenzen definiert werden. Regelmäßige Teambesprechungen und Feedbackrunden können helfen, Unklarheiten und Optimierungspotenzial zu identifizieren.
Alles schließen
-
-
-
Die Ausbildungsstätte soll sicherstellen, dass Ausbildungsärzten aktuelles und qualitativ hochwertiges Lernmaterial zur Verfügung steht, um eine effektive und zeitgemäße medizinische Ausbildung zu gewährleisten. Dazu gehört die Bereitstellung von aktuellen Lehrbüchern, Fachzeitschriften und der Zugang zu relevanten Online-Datenbanken.
Darüber hinaus sollten E-Learning-Plattformen und interaktive Lernmodule genutzt werden, die speziell auf die Bedürfnisse der Ausbildungsärzte zugeschnitten sind. Diese digitalen Lerntools ermöglichen eine flexible und individualisierte Wissensvermittlung und fördern das selbstgesteuerte Lernen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bereitstellung von Videoaufzeichnungen von Operationen und medizinischen Eingriffen. Diese Aufzeichnungen dienen als wertvolle Ressource für die praktische Ausbildung und ermöglichen es den Ausbildungsärzten, komplexe Verfahren zu studieren.
Um sicherzustellen, dass die Ausbildungsärzte die bereitgestellten Ressourcen effektiv nutzen können, sollten Schulungen angeboten werden. Diese Schulungen sollten die Ausbildungsärzte mit den Funktionen und Möglichkeiten der verschiedenen Lernmaterialien vertraut machen und Best Practices für deren Nutzung vermitteln.
Gesetzliche Grundlagen§ 6 Abs 1 KEF und RZ-V 2015 Sofern Kenntnisse und theoretische Grundlagen für die Vermittlung von Erfahrungen und Fertigkeiten verlangt werden, ist darauf zu achten, dass neben der Vermittlung durch die/den Ausbildungsverantwortlichen, den Turnusärztinnen/Turnusärzten Gelegenheit gegeben wird, diese beispielsweise auch im Rahmen von abteilungs- oder spitalsinternen Veranstaltungen, Kongressbesuchen, E-learning Programmen oder der Nutzung einer Bibliothek zu erwerben.
Alles schließen -
Ausbildungsstätten sollen Simulationen als wichtigen Bestandteil der medizinischen Ausbildung anbieten. Simulationen ermöglichen das Erlernen und Üben komplexer klinischer Fähigkeiten in einer sicheren Umgebung, ohne Patienten zu gefährden. Durch wiederholtes Training und die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen, tragen Simulationen zur Verbesserung der Patientensicherheit und zur Stärkung der Handlungskompetenz von Ausbildungsärzten bei. Verschiedene Simulationsformen, von High-Fidelity-Simulatoren über Rollenspiele und Skill-Trainer bis hin zu computergestützten Methoden, können kombiniert werden, um ein umfassendes Training aller relevanten Kompetenzen zu erreichen.
Auch kostengünstigere Optionen und In-situ-Simulationen direkt am Arbeitsplatz bieten effektive Möglichkeiten, realitätsnahes Training zu gestalten. Simulationen fördern nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch Kommunikation, Teamwork, klinisches Urteilsvermögen und Stressmanagement.
Alles schließen -
Die konkrete Umsetzung kann je nach den spezifischen Gegebenheiten und Ressourcen der jeweiligen Einrichtung variieren. Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln eine Lernumgebung zu gestalten, die sowohl strukturiertes Lernen als auch selbstständiges Studium und praktische Übungen ermöglicht und dabei die Bedürfnisse der Ausbildungsärzte berücksichtigt.
Ein Element kann ein flexibel nutzbarer Multifunktionsraum sein, der für verschiedene Lernformate wie Schulungen, Seminare oder Gruppendiskussionen genutzt werden kann. Dieser Raum sollte mit grundlegender technischer Ausstattung wie Beamer, Flipcharts und einer flexiblen Möblierung ausgestattet sein, um verschiedene Lernszenarien zu ermöglichen.
Der Zugang zu Fachliteratur und digitalen Ressourcen ist essentiell und kann durch eine Präsenzbibliothek oder den Zugriff auf digitale Fachbibliotheken und Online-Datenbanken gewährleistet sein.
Für praktische Übungen sollten entweder Simulationszentren errichtet oder Kooperationen mit nahegelegenen Einrichtungen eingegangen werden.
Darüber hinaus kann die Ausbildungsstätte auch Bereiche für den informellen Austausch und das Networking zwischen den Ausbildungsärzten schaffen.Alles schließen -
Die Ausbildungsstätte soll den Ausbildungsärzten einen geeigneten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, der den Anforderungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) und der Bildschirmarbeitsverordnung (BS-V) entspricht.
Jeder Ausbildungsarzt sollte jederzeit über einen eigenen, ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz verfügen, der mit einem Computer ausgestattet ist. Dies ist vor allem notwendig, um den jederzeitigen Zugriff auf relevante Patientendaten zu gewährleisten, insbesondere wenn diese über eine elektronische Patientenakte verfügbar sind. Der Arbeitsplatz muss ausreichend Platz für wechselnde Arbeitshaltungen bieten und genügend Raum für Unterlagen lassen.
Darüber hinaus sollten den Ausbildungsärzten separate Arbeitsplätze mit Computern abseits der patientenversorgenden Einheiten für Selbststudiumszwecke und konzentriertes Arbeiten zur Verfügung stehen. Diese Arbeitsplätze sollten in einer ruhigen Umgebung angesiedelt sein und den Ausbildungsärzten die Möglichkeit bieten, ungestört zu lernen und zu arbeiten. Bei der Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze sind die Vorgaben der BS-V zu berücksichtigen.
Gesetzliche GrundlagenSiehe die gesamte Rechtsvorschrift: Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales über den Schutz der Arbeitnehmer/innen bei Bildschirmarbeit (Bildschirmarbeitsverordnung – BS-V), BGBl ll 1998/124.
Alles schließen
-
-
-
Das Fortbildungsangebot der Abteilungen sollte die spezifischen Bedürfnisse und Lernziele der Ausbildungsärzte berücksichtigen. Eine enge Abstimmung zwischen den Ausbildungszielen und den angebotenen Fortbildungsinhalten ist wichtig, um den Lernerfolg zu optimieren. Darüber hinaus kann ein ergänzendes Fortbildungsangebot speziell für Ausbildungsärzte sinnvoll sein, um deren individuelle Lernbedürfnisse noch gezielter zu adressieren. Dabei gilt es, das vorhandene Expertenwissen und die Lehrkompetenz erfahrener Fachärzte der Ausbildungsstätte zu nutzen. Diese können ihr Wissen und ihre praktischen Erfahrungen an die jungen Kollegen weitergeben und so deren fachliche Weiterentwicklung fördern. Neben medizinisch-fachlichen Inhalten können auch Themen wie Kommunikation, interprofessionelle Zusammenarbeit oder Fehlermanagement Teil des internen Fortbildungsprogramms sein. Diese überfachlichen Kompetenzen sind für die spätere ärztliche Tätigkeit ebenso von großer Bedeutung. Der Einsatz interaktiver Lehrformate und praxisnaher Übungen fördert den Transfer des Gelernten in den klinischen Alltag.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 10 ÄAO 2015 Die Ausbildung hat begleitende theoretische Unterweisungen zu enthalten und Kenntnisse in den für die Ausübung des ärztlichen Berufes einschlägigen Rechtsvorschriften, in der Dokumentation und in der Qualitätssicherung zu vermitteln.
§ 6 Abs 1 KEF und RZ-V 2015 Sofern Kenntnisse und theoretische Grundlagen für die Vermittlung von Erfahrungen und Fertigkeiten verlangt werden, ist darauf zu achten, dass neben der Vermittlung durch die/den Ausbildungsverantwortlichen, den Turnusärztinnen/Turnusärzten Gelegenheit gegeben wird, diese beispielsweise auch im Rahmen von abteilungs- oder spitalsinternen Veranstaltungen, Kongressbesuchen, E-learning Programmen oder der Nutzung einer Bibliothek zu erwerben.
Alles schließen -
Durch die Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen setzen sich die Ausbildungsärzte intensiv mit spezifischen Themen auseinander, recherchieren aktuelle Studien und reflektieren kritisch die Relevanz für die klinische Praxis. Dieser Prozess fördert das Verständnis des Themas und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln. Als Referenten lernen die Ausbildungsärzte, vor Publikum zu sprechen, Fragen zu beantworten und Diskussionen zu moderieren. Sie entwickeln Selbstvertrauen und verbessern ihre kommunikativen Kompetenzen, die auch im klinischen Alltag von großem Wert sind.
Die Ausbildungsstätte sollte transparente Anforderungen an die Ausbildungsärzte stellen, um die Entwicklung entsprechender Kompetenzen zu fördern. Dazu gehören beispielsweise Vorgaben zur Themenwahl, zur Gestaltung der Präsentation und zum Umfang der Recherche. Auch Schulungen zu Präsentationstechniken und Rhetorik können angeboten werden.
Darüber hinaus sollte die Ausbildungsstätte die Ausbildungsärzte bei der Vorbereitung ihrer Fortbildungsbeiträge unterstützen, indem sie ihnen erfahrene Mentoren zur Seite stellt und Ressourcen wie Zugang zu Fachliteratur bereitstellt. Die Anerkennung des zeitlichen Engagements, beispielsweise durch Freistellung von anderen Aufgaben oder die Anrechnung als Fortbildungszeit, schafft zusätzliche Anreize.
Gesetzliche Grundlagen§ 5 Abs 1 KEF und RZ-V 2015 In allen Bereichen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hat die/der Ausbildungsverantwortliche darauf zu achten, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt auch in folgenden ärztlichen Rollen gefördert wird: a) der Kommunikation (Communicator), b) der Zusammenarbeit (Collaborator), c) der Fähigkeit für ein lebenslanges Lernen (Scholar), d) der Bereitschaft, als Fürsprecher des Patienten einzustehen (Health Advocate) e) einer ethisch ärztlichen Haltung (Professional) sowie f) des Managements (Manager).
(2) Der Ausbildungsverantwortliche hat darauf zu achten, dass diese Grundkompetenzen der Turnusärztin/dem Turnusarzt vermittelt werden.Alles schließen -
Es ist wichtig anzuerkennen, dass der Arbeitsplatz für Ausbildungsärzte gleichzeitig auch ein Ausbildungsplatz ist und Fort- und Weiterbildung ebenfalls zur Arbeitszeit gehören sollten.
Es liegt in der Verantwortung der Ausbildungsstätte, durch eine vorausschauende Personalplanung und flexible Arbeitszeitmodelle den Ausbildungsärzten die Möglichkeit zu geben, an internen und externen Fortbildungen teilzunehmen.
Um die Vereinbarkeit von Arbeitsalltag und Fortbildung zu verbessern, können auch E-Learning-Angebote und Webinare bereitgestellt werden, die zeitlich und räumlich flexibel genutzt werden können. Dabei ist es wichtig zu bemerken, dass diese Module auch während der Arbeitszeit absolviert werden können. Gleichzeitig ist es wichtig, Transparenz und Planungssicherheit für die Ausbildungsärzte zu schaffen, um ihnen die Teilnahme an Fortbildungen zu erleichtern. Klare Regelungen bezüglich der Anrechnung von Fortbildungszeiten sind dazu notwendig.
Alles schließen -
Externe Fortbildungen wie Kongresse, Kurse und Workshops sind ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Weiterbildung. Die Ausbildungsstätte sollte Ausbildungsärzte bei der Teilnahme an solchen Veranstaltungen aktiv unterstützen. Dabei ist es wichtig, dass die Fortbildungsangebote mit den individuellen Lernzielen der Ausbildungsärzte abgestimmt sind. Die Ausbildungsstätte sollte über relevante externe Fortbildungsmöglichkeiten informieren und bei der Auswahl geeigneter Veranstaltungen beraten. Ein wesentlicher Aspekt ist die Freistellung von der Arbeit für die Dauer der Fortbildung. Hier sollten klare Regelungen getroffen werden, um eine angemessene Verteilung der Freistellungen unter den Ausbildungsärzten zu gewährleisten. Idealerweise haben Ausbildungsärzte einen Anspruch auf ein festes Kontingent an Fortbildungstagen pro Jahr. Darüber hinaus kann die Ausbildungsstätte finanzielle Unterstützung leisten, indem sie ganz oder teilweise die Kosten für Anmeldung, Reise und Unterkunft übernimmt. Nach der Teilnahme an externen Fortbildungen sollten die Ausbildungsärzte die Gelegenheit erhalten, das Gelernte in der Praxis anzuwenden und an Kollegen weiterzugeben. Die Ausbildungsstätte kann dies fördern, indem sie Plattformen für den Wissensaustausch schafft.
Alles schließen
-
-
-
Durch die regelmäßige Auseinandersetzung mit aktueller Fachliteratur werden nicht nur die fachlichen Kenntnisse der Ausbildungsärzte erweitert, sondern auch ihre Fähigkeiten zur kritischen Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse geschult.
Strukturierte Formate wie Journal Clubs und kommentierte Literaturübersichten können dabei helfen, diese Fähigkeiten systematisch zu entwickeln und zu fördern.
Ein Fokus in der Ausbildung von Ärzten sollte darauf liegen, grundlegende Kompetenzen im Umgang mit wissenschaftlichen Arbeiten zu vermitteln. Dazu gehört, dass Ausbildungsärzte lernen, Studien effizient zu lesen, kritisch zu bewerten und ihre Relevanz für die klinische Praxis einzuschätzen. Sie sollten in der Lage sein, die Schlüsselelemente einer Studie wie Fragestellung, Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu identifizieren und kritisch zu hinterfragen. Auch ein Grundverständnis statistischer Konzepte ist notwendig, um die Aussagekraft von Ergebnissen beurteilen zu können. Weiterhin sollten Ausbildungsärzte befähigt werden, einzelne Studien in den Kontext des aktuellen Forschungsstands einzuordnen und ihre Bedeutung für die Praxis zu evaluieren. Letztlich geht es darum, Studienergebnisse unter Berücksichtigung der individuellen Patientensituation in den klinischen Alltag zu integrieren, um evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können.
Journal Clubs sind ein bewährtes Format, bei dem regelmäßig aktuelle Fachartikel vorgestellt und kritisch diskutiert werden. Die Ausbildungsstätte sollte einen festen Rhythmus für Journal Clubs etablieren und diese in die Arbeitszeit integrieren.
Die aktive Einbindung der Ausbildungsärzte, beispielsweise durch eigene Präsentationen, stärkt die Fähigkeiten im kritischen Umgang mit Studien.
Ergänzend können kommentierte Aussendungen, etwa in Form von E-Mail-Newslettern, den Ausbildungsärzten einen schnellen Überblick über wichtige Publikationen in ihrem Fachgebiet geben. Ausbildungsärzte können gemeinsam mit erfahrenen Fachärzten diese Aussendungen mit kurzen Kommentaren zur klinischen Relevanz und möglichen Implikationen für die Praxis versehen.Gesetzliche Grundlagen§ 4 Abs 8 KEF und RZ-V 2015 In der Ausbildung ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt darin ausgebildet wird, die wissenschaftliche Wertigkeit von fachbezogenen Publikationen und deren Einfluss auf die tägliche Praxis zu interpretieren.
Alles schließen -
Die Vermittlung von Kompetenzen zur Anwendung evidenzbasierter Medizin (EbM) in der klinischen Praxis sollte ein Bestandteil der ärztlichen Ausbildung sein. Ausbildungsärzte müssen lernen, klinische Entscheidungen auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz zu treffen und dabei evidenzbasierte Leitlinien und Empfehlungen zu berücksichtigen.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Schulung der Ausbildungsärzte im effektiven Umgang mit medizinischen Datenbanken und Suchstrategien, um schnell und zielgerichtet die beste verfügbare Evidenz zu finden. Dabei sollten sie lernen, klinische Fragestellungen präzise zu formulieren und anhand geeigneter Schlüsselwörter zu recherchieren.
Neben der Literaturrecherche müssen Ausbildungsärzte auch in der Lage sein, die gefundenen Studien und Leitlinien kritisch zu bewerten. Dazu gehört die Beurteilung der methodischen Qualität, der Aussagekraft und der Übertragbarkeit auf den individuellen Patienten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Integration der evidenzbasierten Medizin in die klinische Entscheidungsfindung.
Fallbesprechungen und klinische Supervision können helfen, diesen Prozess zu üben und zu reflektieren.
Um die Ausbildungsärzte für die Anwendung evidenzbasierter Medizin zu motivieren, sollte die Ausbildungsstätte eine Kultur etablieren, in der das kritische Hinterfragen von Routinen und die Suche nach der besten Evidenz selbstverständlich sind. Ausbildungsfachärzte sollten als Vorbilder dienen und die Prinzipien der EbM vorleben.
Gesetzliche Grundlagen§ 4 Abs 5 KEF und RZ-V 2015 Sämtliche Ausbildungsinhalte sind nach Maßgabe des jeweils aktuellen Standes der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung und nach Maßgabe der jeweils aktuellen, sowohl national wie auch international, medizinischen Methoden, zu absolvieren und umfassen im jeweiligen Ausbildungsinhalt und in der Routineversorgung auch neue Therapieformen, die nach dem Inkrafttreten der Verordnung zur Behandlung von Patientinnen und Patienten herangezogen werden.
§ 4 Abs 8 KEF und RZ-V 2015 In der Ausbildung ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Turnusärztin/der Turnusarzt darin ausgebildet wird, die wissenschaftliche Wertigkeit von fachbezogenen Publikationen und deren Einfluss auf die tägliche Praxis zu interpretieren.
Alles schließen -
Die Ausbildungsstätte soll Ausbildungsärzten die Möglichkeit bieten, wissenschaftliche Tätigkeiten im Rahmen eines neunmonatigen Moduls zu absolvieren. Dies ermöglicht eine fokussierte Forschungsarbeit und fördert die Vereinbarkeit von klinischer Ausbildung und wissenschaftlicher Tätigkeit. Durch die Schaffung eines strukturierten wissenschaftlichen Moduls können Ausbildungsärzte ihre Forschungskompetenzen gezielt entwickeln und vertiefen. Gleichzeitig muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen klinischer Ausbildung und wissenschaftlicher Tätigkeit gewährleistet sein. Die Ausbildungsstätte sollte klare Rahmenbedingungen für das wissenschaftliche Modul definieren, einschließlich Dauer, Anforderungen und Absolvierungszeitpunkt. Sofern kein Modul anerkannt werden kann, sollten alternative Arbeitszeitmodelle zur Integration wissenschaftlicher Tätigkeiten entwickelt werden, die ebenfalls eine Balance zwischen klinischer Praxis und Forschung sicherstellen. Die Förderung wissenschaftlicher Aktivitäten steigert nicht nur die Attraktivität der Ausbildungsstätte für forschungsinteressierte Nachwuchsmediziner, sondern trägt auch zur Stärkung der wissenschaftlichen Reputation der Einrichtung bei.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 6 ÄAO 2015 Das wissenschaftliche Modul umfasst bei allen Sonderfächern jeweils neun Monate.
Alles schließen
-
-
-
Das KA-AZG dient unter anderem dem Schutz der Ärzte vor Überlastung und Übermüdung.
Für Ausbildungsärzte gelten die gleichen Bestimmungen wie für alle anderen Ärzte: Die tägliche Höchstarbeitszeit beträgt 13 Stunden innerhalb von 24 Stunden, während die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten darf, mit einem Durchrechnungszeitraum von maximal 17 Wochen. Bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden ist eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten vorgeschrieben und zwischen zwei Arbeitseinsätzen muss eine ununterbrochene Ruhezeit eingehalten werden.
Nach Abschluss einer entsprechenden Betriebsvereinbarung besteht für Ärzte die Möglichkeit eines Opt-Out, bei dem sie freiwillig einer höheren wöchentlichen Arbeitszeit zustimmen können. Diese Opt-Out-Regelung erlaubt bis 2025 eine maximale wöchentliche Arbeitszeit von 55 Stunden, die sich dann schrittweise bis 2028 auf 52 Stunden reduziert. Allerdings muss die Zustimmung zum Opt-Out ausdrücklich und schriftlich erfolgen. Die Entscheidung muss freiwillig getroffen werden und darf keine negativen Konsequenzen nach sich ziehen, wenn ein Arzt nicht zustimmt.
Die Ausbildungsstätte ist verpflichtet, die Arbeitszeiten genau aufzuzeichnen und die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Verstöße gegen das KA-AZG können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.Gesetzliche GrundlagenSiehe die gesamte Rechtsvorschrift für Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz KA-AZG
Alles schließen -
Überstunden sollten in Ausbildungsstätten nur in begründeten Ausnahmefällen angeordnet werden, etwa bei unvorhersehbaren Ereignissen oder dringenden Patientenfällen. Ein regelmäßiger Einsatz von Überstunden, um personelle Engpässe auszugleichen oder den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten, ist nicht zulässig.
Werden Überstunden geleistet, sollte ein Anspruch auf zeitnahen Ausgleich durch Freizeit bestehen.
Eine Abgeltung von Überstunden durch Geld ist mit Zustimmung des Ausbildungsarztes möglich.
Die Ausbildungsstätte muss sicherstellen, dass der Freizeitausgleich tatsächlich zeitnah erfolgt und nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Hierfür sind verbindliche Regelungen und Prozesse erforderlich.Überstunden und Freizeitausgleich müssen präzise dokumentiert werden. Dies dient nicht nur der Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sondern auch dem Schutz der Ausbildungsärzte vor übermäßiger Belastung. Eine elektronische Zeiterfassung und regelmäßige Auswertung der Arbeitszeitkonten sind hierfür geeignete Instrumente.
Ausbildungsverantwortliche sollen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Überstunden sensibilisiert sein.
Gesetzliche Grundlagen§ 5 KA-AZG (2) Dienstnehmer/innen dürfen außerhalb der festgelegten Arbeitszeiteinteilung zu Überstundenarbeit nur herangezogen werden, wenn berücksichtigungswürdige Interessen der Dienstnehmer/innen der Überstundenarbeit nicht entgegenstehen.
(3) Für Überstundenarbeit gebührt ein Zuschlag von 50 vH. Der Berechnung dieses Zuschlages ist der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende Normallohn zugrunde zu legen.Alles schließen -
Insgesamt erfordert die Umsetzung von Teilzeitmodellen in der Ausbildung ein hohes Maß an Organisation und Flexibilität seitens der Ausbildungsstätte. Teilzeitoptionen steigern jedoch auch die Attraktivität der Ausbildungsstätte und leisten einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung des ärztlichen Nachwuchses. Dabei geht es vor allem darum, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bzw. Familie zu fördern und auf individuelle Lebenssituationen Rücksicht zu nehmen.
Laut § 11 ÄrzteG 1988 gilt für Ärzte in Ausbildung eine 35-Stunden-Woche als Vollanrechnung, wobei mindestens 25 Stunden in der Kernarbeitszeit zwischen 7:00 und 16:00 Uhr zu absolvieren sind.
Bei der Anrechnung der Ausbildungszeit wird auf das im Dienstvertrag vereinbarte Beschäftigungsausmaß abgestellt, unabhängig von der tatsächlich geleisteten Stundenanzahl. Bei einer Teilzeitbeschäftigung verlängert sich die Ausbildungszeit entsprechend.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, in Dienstverträgen Nachtdienste in der Gesamtstundenanzahl zu berücksichtigen, um eine Gesamtzahl von 35 Stunden zu erreichen.
§ 7 ÄAO 2015 sieht für eine Teilzeitbeschäftigung eine Untergrenze von 12 Wochenstunden bei einer Ausbildung im Spital und von 15 Wochenstunden in einer Lehrpraxis vor.
Auch bei einer Teilzeitbeschäftigung muss die Qualität der Ausbildung gewährleistet sein. Die Ausbildungsstätte hat sicherzustellen, dass Ausbildungsärzte in Teilzeit alle erforderlichen Inhalte und Kompetenzen vermittelt bekommen, die im Rasterzeugnis für das jeweilige Fachgebiet definiert sind.
Dazu gehört, dass die Teilzeitbeschäftigten in ausreichendem Maße an den regulären Ausbildungsaktivitäten wie Visiten, Besprechungen, Fortbildungen und praktischen Anleitungen teilnehmen können. Auch die Rotation durch verschiedene Abteilungen und Funktionsbereiche muss so geplant werden, dass alle vorgesehenen Stationen durchlaufen werden. Insgesamt darf die reduzierte Arbeitszeit nicht zulasten der Ausbildungsinhalte gehen.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 ÄrzteG 1998 (8) Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist, sofern sich in Ausnahmefällen aus der Einhaltung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997, nicht anderes ergibt, die Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer Kernausbildungszeit von 35 Wochenstunden auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. Zusätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste zu absolvieren. Die Kernausbildungszeit hat zu gewährleisten, dass die Ausbildung der Turnusärzte möglichst in den Hauptzeiten, in denen der überwiegende Teil des fachärztlichen Stammpersonals in der Ausbildungsstätte anwesend ist, absolviert wird. Von den 35 Wochenstunden sind jedenfalls 25 Stunden in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr zu absolvieren, wobei die in Ausbildungsstätten zusätzlich zu absolvierenden Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste entsprechend zu berücksichtigen sind.
(9) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt auf dessen Wunsch Teilzeitbeschäftigung vereinbart werden. Die vereinbarte Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwölf Stunden pro Woche betragen. Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert.§ 7 ÄAO 2015 (1) Sofern mit der Turnusärztin/dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung vereinbart wird, verlängert sich die jeweilige Gesamtdauer der Basisausbildung, der Ausbildung in den Fachgebieten der allgemeinärztlichen Ausbildung, der Sonderfach-Grundausbildung sowie der Sonderfach-Schwerpunktausbildung aliquot.
(2) Bei Teilzeitbeschäftigung einer Turnusärztin/eines Turnusarztes kann von dieser Turnusärztin/diesem Turnusarzt nicht gleichzeitig eine weitere Teilzeitbeschäftigung zur ärztlichen Ausbildung absolviert werden.
(3) Bei Teilzeitbeschäftigung einer Turnusärztin/eines Turnusarztes sind zwei Drittel der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr zu absolvieren.
(4) Das Gesamtausmaß der Ausbildungszeit bei Teilzeitbeschäftigung darf pro Ausbildungsstelle 35 Wochenstunden nicht übersteigen, wobei eine Ausbildung einer Turnusärztin/eines Turnusarztes auch auf mehreren Ausbildungsstellen derselben anerkannten Ausbildungsstätte erfolgen kann.Alles schließen
-
-
-
Die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit von Ausbildungsärzten erfordert eine sorgfältige Dienstplanung und Koordination durch die Ausbildungsverantwortlichen.
Ein zentraler Aspekt ist die Definition einer Kernausbildungszeit von 35 Stunden pro Woche, in der die wesentlichen Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Mindestens 25 Stunden müssen davon in der Zeit von 7:00 bis 16:00 Uhr absolviert werden. Diese Konzentration auf den Tagdienst stellt sicher, dass die Auszubildenden ausreichend an den wichtigsten Ausbildungsaktivitäten teilnehmen können, die vorwiegend in diesem Zeitraum stattfinden und von erfahrenen Fachärzten angeleitet werden.
Die restlichen 10 Stunden der Kernausbildungszeit können flexibel in Früh-, Spät- oder Nachtdiensten geleistet werden. Nachtdienste sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, da sie spezifische Kompetenzen vermitteln, die für die selbstständige ärztliche Tätigkeit unerlässlich sind. Die durch Nachtdienste entstehenden Kompensationszeiten dürfen jedoch nicht zu einer Verkürzung der Ausbildungszeit am Tag führen. Insgesamt ist auf eine gleichmäßige Verteilung der Gesamtwochendienstzeit über die Arbeitstage zu achten. Eine ausgewogene Balance zwischen Tag- und Nachtdiensten sowie Freizeitausgleich ist anzustreben. Über die Kernausbildungszeit hinaus geleistete Dienste sind zusätzlich als Arbeitszeit zu werten und entsprechend zu kompensieren.
Die Erstellung von Dienstplänen erfordert eine enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten. Individuelle Bedürfnisse sollten nach Möglichkeit berücksichtigt werden, soweit dies mit den Erfordernissen der Patientenversorgung und der Ausbildung vereinbar ist.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 8 ÄrzteG 1998 Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist, sofern sich in Ausnahmefällen aus der Einhaltung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997, nicht anderes ergibt, die Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer Kernausbildungszeit von 35 Wochenstunden auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. Zusätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste zu absolvieren. Die Kernausbildungszeit hat zu gewährleisten, dass die Ausbildung der Turnusärzte möglichst in den Hauptzeiten, in denen der überwiegende Teil des fachärztlichen Stammpersonals in der Ausbildungsstätte anwesend ist, absolviert wird. Von den 35 Wochenstunden sind jedenfalls 25 Stunden in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr zu absolvieren, wobei die in Ausbildungsstätten zusätzlich zu absolvierenden Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste entsprechend zu berücksichtigen sind.
Alles schließen -
Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste stellen einen wichtigen Bestandteil der ärztlichen Ausbildung dar, da sie spezifische Lerninhalte und Kompetenzen vermitteln, die für die selbstständige ärztliche Tätigkeit unerlässlich sind. Dazu gehört etwa der Umgang mit Notfällen, die Priorisierung von Aufgaben und die interprofessionelle Zusammenarbeit unter erschwerten Bedingungen. Laut Ärztegesetz und Ärzteausbildungsordnung 2015 müssen Ausbildungsärzte, sofern fachlich erforderlich und dienst- bzw. arbeitsrechtlich zulässig, zumindest einen Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsdienst pro Monat in einem Durchrechnungszeitraum von neun Monaten absolvieren. Die fachliche Erforderlichkeit ist von der ärztlichen Leitung bzw. den Ausbildungsverantwortlichen festzustellen.
Gesetzliche Grundlagen§ 8 ÄAO 2015 (1) Sofern fachlich erforderlich und dienst- bzw. arbeitsrechtlich zulässig, ist von einer Turnusärztin/einem Turnusarzt zumindest ein fachbezogener Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsdienst pro Monat in einem Durchrechnungszeitraum von neun Monaten zu absolvieren.
(2) Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert sich der Durchrechnungszeitraum und die erforderliche Absolvierung von Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsdiensten gemäß Abs. 1 entsprechend dem Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung.§ 6 ÄAO 2015 (1) Basisausbildung bezeichnet den ersten Teil der Ausbildung für jede Ärztin/jeden Arzt in der Dauer von zumindest neun Monaten zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten, sofern in den Anhängen zu dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist. Ziel der Basisausbildung ist die Befähigung der Ärztin/des Arztes im Rahmen von Nacht-, Feiertags- oder Wochenenddiensten Patientinnen/Patienten einer Fachabteilung oder Organisationseinheit im Umfang der gemäß Abs. 3 erworbenen Kompetenzen zu versorgen sowie zum Management von intramuralen Notfallsituationen bis zum Eintreffen höherwertiger Hilfe.
Alles schließen -
Die ständige Erreichbarkeit von Ausbildungsfachärzte während der Nachtdienste ist nicht nur für die Qualität der Ausbildung, sondern auch aus rechtlicher Sicht unerlässlich. Gemäß § 3 Abs 3 ÄrzteG 1998 dürfen Ausbildungsärzte nur unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte selbstständig medizinisch tätig werden. Klare Regelungen und zuverlässige Kommunikationskanäle sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Ausbildungsfachärzte jederzeit für Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung stehen. Besonders in dringenden oder unerwarteten Situationen ist der rasche Zugang zu erfahrenen Kollegen entscheidend.
Gesetzliche Grundlagen§ 3 ÄrzteG 1998 (1) Die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist ausschließlich Ärztinnen/Ärzten für Allgemeinmedizin, approbierten Ärztinnen/Ärzten, Fachärztinnen/Fachärzten und Ärztinnen/Ärzten mit partiellem Berufszugang (§ 5a Abs. 1a) vorbehalten.
(…)
(3) Die in Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin/zum Facharzt befindlichen Ärztinnen/Ärzte (Turnusärztinnen/Turnusärzte) sind lediglich zur unselbstständigen Ausübung der im § 2 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten im Rahmen
1. der gemäß den §§ 6a, 9 und 10 anerkannten Ausbildungsstätten,
2. von Organisationseinheiten an Krankenanstalten, an die organisierte Notarztdienste angebunden sind (§ 40 Abs. 4) sowie
3. der gemäß den §§ 12, 12a und 13 bewilligten Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen und Lehrambulatorien
unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärztinnen/Ärzte berechtigt. Sofern krankenanstaltenrechtliche Organisationsvorschriften keine dauernde Anwesenheit einer Fachärztin/eines Facharztes erfordern, können Turnusärztinnen/Turnusärzte vorübergehend auch ohne Aufsicht einer/eines für die Ausbildung verantwortlichen Fachärztin/Facharztes an einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit für ein Sonderfach tätig werden, sofern sie bereits im Rahmen des Turnus in dem betreffenden Sonderfach hinreichend ausgebildet worden sind, und über die für ein vorübergehendes Tätigwerden ohne Aufsicht entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, wobei ein gleichzeitiges Tätigwerden für mehr als eine Abteilung oder Organisationseinheit unzulässig ist.Alles schließen -
Die Ausbildungsstätte sollte die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung der Vor- und Nachbesprechungen schaffen. Dazu gehören geeignete Räumlichkeiten, eine angemessene zeitliche und personelle Ressourcenplanung sowie die Verankerung der Besprechungen in den Dienstplänen und Arbeitsabläufen.
In der Vorbesprechung können die Ausbildungsfachärzte und -ärzte die Erwartungen für den bevorstehenden Nachtdienst klären, besondere Patientenfälle diskutieren, organisatorische Fragen abstimmen und Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten thematisieren. Die Nachbesprechung dient dazu, die Ereignisse des Nachtdienstes strukturiert aufzuarbeiten. Hier haben die Ausbildungsärzte Gelegenheit, von herausfordernden Situationen zu berichten und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Auch positive Erfahrungen und gelungene Teamarbeit sollten gewürdigt werden.
Alles schließen
-
-
-
Ein strukturiertes Supervisionsangebot ist entscheidend, um Ausbildungsärzte bei der Bewältigung von berufsbedingtem Stress und der Prävention von Burnout zu unterstützen.
Dieses Angebot kann regelmäßige Einzel- und Gruppensupervisionen umfassen, die von qualifizierten Fachkräften wie Psychologen oder erfahrenen Coaches durchgeführt werden.
Ergänzend dazu sind thematische Workshops und Seminare zu Stressbewältigung, Resilienz, Kommunikation und Work-Life-Balance sinnvoll. Diese können als Präsenzveranstaltungen oder Online-Formate stattfinden und durch externe Experten bereichert werden.
Fallberatung und Intervisionsgruppen bieten eine Plattform für den Austausch unter den Ausbildungsärzten und die gegenseitige Unterstützung. Diese Treffen sollten von erfahrenen Ärzten oder Psychologen moderiert werden. Die Ausbildungsstätte sollte zudem Informations- und Selbsthilfematerialien wie Bücher, Videos, Podcasts sowie Zugang zu Online-Plattformen und Apps bereitstellen, um das selbstgesteuerte Lernen zu fördern.
Eine Anlaufstelle für individuelle Unterstützung kann ebenfalls sinnvoll sein. Hier sollten benannte Ansprechpartner für vertrauliche Einzelgespräche zur Verfügung stehen und bei Bedarf eine Vermittlung an externe Therapeuten oder Coaches ermöglichen.
Zur erfolgreichen Etablierung des Supervisionsangebots bedarf es eines klaren Konzepts, das unter Einbezug der Ausbildungsärzte entwickelt wird. Qualifizierte Supervisoren müssen gewonnen und die notwendigen Rahmenbedingungen wie Räume, Zeitfenster und Budgets geschaffen werden.
Letztlich erfordert ein solches Angebot das Commitment der Führungsebene, Ressourcen und eine Organisationskultur, die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ernst nimmt.
Gesetzliche Grundlagen§ 17 Abs 8 ÄAO 2015 In der Ausbildung ist der Erwerb psychosozialer Kompetenz vorzusehen, der auch Supervision mit der Möglichkeit zur Selbstreflexion mit einzuschließen hat.
Alles schließen -
Besonders in der Ausbildung von Ärzten ist es wichtig, eine positive Einstellung zu Fehlern zu entwickeln. Systeme wie das Critical Incident Reporting (CIRS) sind wertvolle Werkzeuge, um systematisch aus Fehlern und Beinahe-Fehlern zu lernen. Diese anonymen Meldesysteme erlauben es, kritische Vorfälle ohne Schuldzuweisungen zu untersuchen und daraus Verbesserungen abzuleiten. Die Einführung von CIRS in Krankenhäusern hat gezeigt, dass dadurch systembedingte Probleme erkannt und proaktiv behoben werden können.
Für angehende Ärzte ist es besonders wichtig, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern zu erlernen. Sie befinden sich in einer sensiblen Phase, in der sie einerseits lernen und andererseits bereits Verantwortung tragen müssen. Wenn sie frühzeitig lernen, Fehler zuzugeben und daraus lernen, können sie nicht nur ihre eigene Praxis verbessern, sondern auch zu einer offeneren Fehlerkultur in der gesamten medizinischen Gemeinschaft beitragen. Ausbildungsstätten sollten daher einen Rahmen schaffen, in dem Fehler ohne Angst vor negativen Konsequenzen gemeldet und besprochen werden können.
Führungskräfte und erfahrene Ärzte sollten dabei als Vorbilder agieren, indem sie offen über ihre eigenen Fehler sprechen und diese als Lernchance nutzen.
Alles schließen
-
-
-
-
-
Regelmäßige strukturierte Überprüfungen der Ausbildungsorganisation sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Ausbildungsprogramme den aktuellen Anforderungen entsprechen und die Ausbildungsziele effektiv erreicht werden.
Unter Ausbildungsorganisation versteht man in diesem Kontext das gesamte Ausbildungskonzept, einschließlich der Rotationen, der angewandten Ausbildungsmethoden, der Leistungsüberprüfung und der personellen Verantwortung. Eine Überprüfung sollte sicherstellen, dass das Ausbildungskonzept aktuell und praxistauglich ist und dass die Ausbildungsmethoden sowie die klinische Lernumgebung den Ausbildungszielen entsprechen und zur effektiven Ausbildung der Ärzte beitragen. Zudem muss überprüft werden, ob die Leistungsüberprüfung in der vorgesehenen Form stattfindet und ob diese Form geeignet ist, um die Kompetenzen der Ausbildungsärzte angemessen zu bewerten. Auch die Verteilung der personellen Verantwortung sollte adäquat sein. Die Überprüfung sollte in regelmäßigen Intervallen, beispielsweise alle drei Jahre, erfolgen. Zusätzlich sollten anlassbezogene Überprüfungen stattfinden, wenn sich wesentliche Veränderungen in der Ausbildungsstruktur ergeben.
Um eine umfassende Reflexion zu erreichen, können verschiedene Arten der Überprüfung und Maßstäbe etabliert werden: Zunächst sollte überprüft werden, ob geltende und gegebenenfalls veränderte Gesetze sowie neue Standards in der Ausbildungsorganisation berücksichtigt werden. Revisionsprozesse der schriftlich festgelegten Ausbildungsorganisation, einschließlich interner Richtlinien und Leitlinien, die die Ausbildung betreffen, sollten eingerichtet sein. Ein Vergleich mit anderen Ausbildungsstätten, entweder innerhalb derselben Trägerschaft oder mit fachverwandten externen Einrichtungen, ermöglicht es, innovative Ansätze und bewährte Verfahren zu identifizieren und in die eigene Praxis zu integrieren. Organisationsüberprüfungen durch Audits bieten eine objektive Bewertungsebene. Diese können durch abteilungsunabhängige Stellen innerhalb der Trägerschaft erfolgen oder durch externe Audits von unabhängigen Beratern oder Institutionen, die eine unvoreingenommene Perspektive bieten.
Darüber hinaus sind Visitationen gesetzlich verankert und werden von den Ämtern der Landesregierungen durchgeführt. Diese Visitationen können sowohl anlassbezogen, auf begründete Anregung von Ausbildungsärzten, Ausbildungsverantwortlichen, der Österreichischen Ärztekammer oder der Landesärztekammern, als auch stichprobenartig erfolgen. Sie bieten eine wertvolle Gelegenheit, die bestehenden Strukturen und Prozesse der Ausbildungsorganisation umfassend zu überprüfen. Ausbildungsstätten sollten diese Visitationen als Chance nutzen, um systematische Schwachstellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Optimierung zu ergreifen.
Gesetzliche Grundlagen§ 11 Abs 6 ÄrzteG 1998 Der Träger der Ausbildungsstätte hat jede Änderung der für die Anerkennung und für den Fortbestand als Ausbildungsstätte oder einer Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.
Alles schließen -
Ein effektives Feedbacksystem in der Ausbildungsstätte ist entscheidend, um den Auszubildenden eine Stimme zu geben und kontinuierliche Verbesserungen in der Ausbildung zu fördern. Das Einholen von Feedback ermöglicht es, wertvolle Einblicke in die Erfahrungen und Herausforderungen der Auszubildenden zu gewinnen, die andernfalls unbemerkt bleiben könnten. Zudem kann es das Engagement und die Zufriedenheit der Auszubildenden steigern, wenn sie aktiv am Verbesserungsprozess teilnehmen können. Digitale Plattformen oder Feedback-Boxen bieten eine einfache und zugängliche Möglichkeit, Meinungen auch anonym zu äußern. Darüber hinaus können regelmäßige Gruppen-Evaluierungen zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Ausbildungsärzten in einem geschützten Rahmen stattfinden, idealerweise zwei- bis viermal jährlich. Diese Treffen fördern den direkten Austausch und ermöglichen es, spezifische Themen in einem offenen Dialog zu besprechen. Strukturierte Umfragen, entweder digital oder schriftlich, können auf Trägerebene oder Abteilungsebene durchgeführt werden, um systematisches Feedback zu sammeln. Diese Umfragen können stichtagsbezogen oder am Ende der Ausbildung erfolgen. Ansprechpersonen wie Spitalsärztesprecher oder Vertreter aus den Reihen der Ausbildungsärzte, die die Interessen der Ausbildungsärzte vertreten, können ebenfalls als wichtige Bindeglieder fungieren. Die Ergebnisse des Feedbacks sollten transparent kommuniziert werden, ebenso wie die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Dies zeigt den Auszubildenden, dass ihre Rückmeldungen ernst genommen werden und tatsächlich zu Verbesserungen führen.
Alles schließen -
Die systematische Erfassung und Auswertung von Ausbildungsdaten bietet ein objektives und messbares Instrument zur Optimierung der Ausbildungsprozesse.
Zu den relevanten Daten zählen die von der Abteilung erbrachten Leistungen, die aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) stammen. Diese lassen sich anhand des Definitionshandbuchs des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz den Ausbildungszielen im Rasterzeugnis zuordnen.
Leistungsdaten werden auch vom Bundesministerium bereitgestellt, da sie beispielsweise für die Beantragung neuer Stellen oder die Erweiterung von Ausbildungsplätzen benötigt werden. Diese Daten bieten eine fundierte Grundlage für die Beurteilung der aktuellen Ausbildungskapazitäten.
Weitere relevante Daten umfassen Zeiterfassungsdaten, die Aufschluss über die Arbeitszeiterfassung und die Auslastung bestimmter Rotationsplätze geben. Daten können nicht nur für retrospektive Analysen genutzt werden, sondern auch auf zukünftige Entwicklungen und Trends hinweisen. Geeignete Softwarelösungen, sowohl aus dem KIS selbst als auch aus speziellen Programmen für die Ausbildungsorganisation wie Rotationsplanungsprogramme und Logbücher, unterstützen die effiziente Datenverwaltung und -analyse.
Gesetzliche Grundlagen§ 13d ÄrzteG 1998 (1) Die systematische Darstellung von technischen Definitionen von in Ausbildungsstätten gemäß §§ 9 und 10 sowie in Spezialisierungsstätten gemäß § 11a Abs. 2 Z 1 iVm § 11b gemäß der Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 11a Abs. 3 zu vermittelnden Fertigkeiten im Sinne einer Gegenüberstellung von
1. Leistungskennzahlen aus dem Dokumentations- und Informationssystem für Analysen im Gesundheitswesen (DIAG) gemäß dem Bundesgesetz über Dokumentation im Gesundheitswesen und
2. Richtzahlen gemäß der Verordnungen gemäß § 24 Abs. 2 und § 11a Abs. 3
bildet das Definitionenhandbuch der Fertigkeiten für die ärztliche Aus- uns Weiterbildung.
(2) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat das Definitionenhandbuch für die ärztliche Aus- und Weiterbildung unter Mitwirkung der Kommission für die ärztliche Ausbildung gemäß § 6b und der Österreichischen Ärztekammer zu erarbeiten, weiterzuentwickeln und als Anlage zur Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 kundzumachenAlles schließen
-
-
-
Die jährliche Evaluierung, durchgeführt von der Österreichischen Ärztekammer in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, bietet wertvolle Einblicke in die Ausbildungsqualität und basiert auf einem bewährten Modell, das auch in der Schweiz und Deutschland erfolgreich angewendet wird.
Die Ergebnisse der Evaluierung, die auf der Homepage der Österreichischen Ärztekammer veröffentlicht werden, dienen nicht nur der internen Verbesserung, sondern stellen auch einen Wettbewerbsfaktor dar. Eine transparente Darstellung der Ergebnisse kann den Ruf der Ausbildungsstätte erheblich beeinflussen und bietet somit einen starken Anreiz, die Ausbildungsqualität kontinuierlich zu verbessern.
Um die Teilnahme zu fördern, sollten Ausbildungsstätten die Bedeutung der Evaluierung in Besprechungen und über digitale Kanäle hervorheben.
Es ist wichtig, den Ausbildungsärzten ausreichend Zeit und Ressourcen für die Teilnahme zur Verfügung zu stellen. Dies kann durch die Einrichtung fester Zeitfenster während der Arbeitszeit geschehen, um die Teilnahme zu erleichtern und zu zeigen, dass die Evaluierung als Priorität angesehen wird.
Alles schließen -
Die Ergebnisse der nationalen Evaluierung sollten genutzt werden, um gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität zu entwickeln. Eine Möglichkeit besteht darin, die Analyse der Ergebnisse gemeinsam mit den Ausbildungsärzten durchzuführen oder im Rahmen von Teambesprechungen mit den Ausbildungsfachärzten zu diskutieren. Dieser kollaborative Ansatz fördert die Identifikation von Schwachstellen und die Entwicklung von praxisnahen Lösungen. Durch die Aufteilung der Evaluierung in acht Themenfelder—Globalbeurteilung der Ausbildungsstätte, Fachkompetenz, Lernkultur, Führungskultur, Fehlerkultur und Patientensicherheit, Entscheidungskultur, Betriebskultur und evidenzbasierte Medizin—können spezifische Verbesserungsfelder klar identifiziert werden. Die zusammengefassten Ergebnisse der einzelnen Ausbildungsstätten werden den Resultaten einer geeigneten Vergleichsgruppe gegenübergestellt und in einer übersichtlichen Spinnengrafik veröffentlicht, was einen direkten Vergleich ermöglicht. Ausbildungsverantwortliche Abteilungsvorstände erhalten zusätzlich einen umfassenden Detailbericht über die Ergebnisse ihrer Abteilung. Dieser Bericht bietet eine tiefgehende Analyse der Stärken und Schwächen und dient als Grundlage für die Entwicklung spezifischer Verbesserungsstrategien.
Alles schließen
-
-
-
Ausbildung
Ausbildung bezeichnet den strukturierten Prozess, in dem angehende Ärzte die notwendigen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten erwerben, um in ihrem jeweiligen medizinischen Fachgebiet tätig zu werden. Die Ausbildung findet in anerkannten Ausbildungsstätten statt. Die Ausbildung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die Ärzte am Ende ihrer Ausbildung in der Lage sind, eigenständig und verantwortungsbewusst zu praktizieren.Ausbildungsarzt/Turnusarzt
Ein Ausbildungsarzt, auch als Turnusarzt bezeichnet, ist ein Mediziner, der sich in der Basisausbildung, der Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Fachärztin/zum Facharzt befindet. Diese Ärzte stehen in einem Ausbildungsverhältnis mit einer anerkannten Ausbildungsstätte.Ausbildungsfachärzte
Ausbildungsfachärzte sind alle Ärzte, die zur selbstständigen Berufsausübung befähigt sind, an der jeweiligen Ausbildungsstätte tätig sind und in die Ausbildung eingebunden sind. Sie sind verantwortlich für die Mitwirkung an der Ausbildung der Ausbildungsärzte und tragen dazu bei, dass diese die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten für die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufs erwerben.Ausbildungsverantwortliche
Der Ausbildungsverantwortliche ist die Person, die die Gesamtverantwortung für die Organisation, Durchführung und Qualität der ärztlichen Ausbildung in einer Ausbildungsstätte trägt. Diese Rolle liegt beim Leiter einer jeweiligen Abteilung/ Organisationseinheit einer anerkannten Ausbildungsstätte. Aufgaben des Ausbildungsverantwortlichen können an einen Facharzt derselben Ausbildungsstätte delegiert werden.Ausbildungsstätte
Eine Ausbildungsstätte ist eine medizinische Einrichtung oder Abteilung, die mit Bescheid von der zuständigen Behörde anerkannt wurde, um Ärzte in verschiedenen Ausbildungsphasen auszubilden. Diese Ausbildung kann die Basisausbildung, die Ausbildung in der Allgemeinmedizin oder die fachärztliche Ausbildung umfassen. Eine solche Anerkennung bestätigt, dass die Einrichtung die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um den Ausbildungsärzten die erforderlichen theoretischen und praktischen Fähigkeiten zu vermitteln. Es ist auch möglich, dass eine medizinische Organisationseinheit mehrere Ausbildungsstätten betreibt, die für unterschiedliche Ausbildungsarten zugelassen sind. Die Ausbildungsstätte stellt sicher, dass die Ausbildungsinhalte gemäß den festgelegten Standards und Anforderungen vermittelt werden.Erfahrungen
„Erfahrungen“ bezeichnen jene empirischen Wahrnehmungen ärztlicher Tätigkeiten in aktiver und passiver Rolle im Zuge der Betreuung von Patienten, die in der Folge im Rahmen der eigenen ärztlichen Tätigkeit verwertet werden sollen.Evaluierungsgespräch
Ein Evaluierungsgespräch ist ein formelles Gespräch zwischen dem Ausbildungsverantwortlichen und dem Ausbildungsarzt, in dem der Fortschritt des Ausbildungsarztes bewertet wird. Dabei werden die vermittelten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten besprochen und dokumentiert. Das Evaluierungsgespräch dient der Überprüfung der Ausbildungsziele und bietet die Gelegenheit, Stärken und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Es findet zu festgelegten Zeitpunkten während der Ausbildung statt und ist Grundlage für die Ausstellung eines Rasterzeugnisses, das den aktuellen Ausbildungsstand bestätigt.Fertigkeiten
„Fertigkeiten“ bezeichnen jene ärztlichen Tätigkeiten, die der Arzt unmittelbar am oder mittelbar für Menschen ausführt. Dazu gehört insbesondere die praktische Anwendung bestimmter Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie sonstige manuelle und technische Handlungen.Formative Leistungsbeurteilung
Die formative Leistungsbeurteilung ist ein fortlaufender Bewertungsprozess während der ärztlichen Ausbildung, der darauf abzielt, den Ausbildungsarzt regelmäßig zu unterstützen und ihm kontinuierliches Feedback zu seinen Fortschritten zu geben. Im Gegensatz zur summativen Beurteilung, die eine abschließende Bewertung darstellt, zielt die formative Beurteilung darauf ab, Schwächen frühzeitig zu erkennen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Sie umfasst unter anderem das Führen eines Logbuchs oder Leistungsportfolios, regelmäßiges Feedback durch die Ausbildungsfachärzte und die Durchführung arbeitsplatzbasierter Assessments (AbAs). Die formative Leistungsbeurteilung dient dazu, den Lernfortschritt zu überwachen und die Ausbildung gezielt zu steuern.Kenntnisse
„Kenntnisse“ bezeichnen das theoretische Wissen als Grundlage für die praktische Ausführung ärztlicher Tätigkeiten. Dazu gehört das Wissen über Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anderer ärztlicher oder sonstiger gesundheitsberuflicher Tätigkeitsbereiche sowie die Fähigkeit, Befunde und Berichte von Ärzten anderer medizinischer Fachrichtungen und Angehörigen sonstiger Gesundheitsberufe im Hinblick auf die eigene ärztliche Tätigkeit zu interpretieren.Rasterzeugnis
Ein Rasterzeugnis ist ein standardisiertes Dokument, das die während der ärztlichen Ausbildung vermittelten Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten eines Ausbildungsarztes festhält. Es dient als offizieller Nachweis darüber, welche Lernziele erreicht wurden und in welchem Umfang die erforderlichen Kompetenzen vermittelt wurden. Das Rasterzeugnis wird in regelmäßigen Abständen und nach festgelegten Ausbildungsabschnitten ausgestellt und muss vom Ausbildungsverantwortlichen unterzeichnet werden.Rotation
Eine Rotation ist ein geplanter Wechsel eines Ausbildungsarztes zwischen verschiedenen Abteilungen, Organisationsbereichen oder Arbeitsplätzen innerhalb derselben Ausbildungsstätte oder auch zwischen verschiedenen medizinischen Einrichtungen. Ziel der Rotation ist es, dem Ausbildungsarzt ein breites Spektrum an Erfahrungen und Fertigkeiten in unterschiedlichen Fachbereichen und unter verschiedenen Bedingungen zu vermitteln. Die Rotationspläne werden von der Ausbildungsstätte erstellt und sollen den Ausbildungsärzten frühzeitig kommuniziert werden.Alles schließen -
Ärztegesetz 1998 (ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169/1998, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 195/2023
KEF- und RZ-VO 2015, zuletzt geändert durch 5. Novelle - 17. Dezember 2021
Bildschirmarbeitsverordnung (BS-V), BGBl. II Nr. 124/1998
Brauer, D.G., & Ferguson, K.J. (2015). The integrated curriculum in medical education: AMEE Guide No. 96. Medical Teacher, 37, 312-322.
Brown, D.D., Ewy, G.A., Feinberg, L., Felner, J.M., Gessner, I.H., Gordon, D.L., Issenberg, B.S., McGaghie, W.C., Millos, R., Petrusa, E., Pringle, S., Scalese, R.J., Small, S.D., Waugh, R.A., & Ziv, A. (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: A BEME systematic review. Medical Teacher, 27, 10-28.
Cook, D.A., Levinson, A.J., Garside, S., Dupras, D.M., Erwin, P.J., & Montori, V.M. (2008). Internet-based learning in the health professions: A meta-analysis. JAMA, 300(10), 1181-96.
Frögéli, E., Jenner, B., & Gustavsson, P. (2023). Effectiveness of formal onboarding for facilitating organizational socialization: A systematic review. PloS One, 18(2).
Frank, J.R., Snell, L., & Sherbino, J. (Eds.). (2015). CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
Jones, R., Higgs, R., Angelis, C., & Prideaux, D. (2001). Changing face of medical curricula. The Lancet, 357, 699-703.
Lorenzetti, D., Quan, H., Lucyk, K., Cunningham, C., Hennessy, D., Jiang, J., & Beck, C. (2018). Strategies for improving physician documentation in the emergency department: A systematic review. BMC Emergency Medicine.
Norcini, J., & Burch, V. (2007). Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Medical Teacher, 29(9–10), 855–871.
Srinivasan, M., Li, S., Meyers, F., Pratt, D., Collins, J., Braddock, C., Skeff, K., West, D., Henderson, M., Hales, R., & Hilty, D. (2011). "Teaching as a Competency": Competencies for medical educators. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 86(10), 1211-20.
Thomas, P.A., Kern, D.E., Hughes, M.T., & Chen, B. (1998). Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach.
Tochel, C., Haig, A., Hesketh, A., Cadzow, A., Beggs, K., Colthart, I., & Peacock, H. (2009). The effectiveness of portfolios for post-graduate assessment and education: BEME Guide No. 12. Medical Teacher, 31, 299-318.
van de Ridder, J.M., Stokking, K.M., McGaghie, W.C., & ten Cate, O. (2008). What is feedback in clinical education? Medical Education, 42.
Im Rahmen Erstellung dieser Leitlinie wurden KI-basierte Tools eingesetzt, um die Recherche und Formulierung von Textpassagen zu unterstützen. Dabei wurde darauf geachtet, dass alle durch die KI generierten Inhalte sorgfältig überprüft und angepasst wurden, um ihre Genauigkeit und Relevanz zu gewährleisten. Die Verantwortung für die endgültigen Inhalte liegt vollständig bei den Autoren, die die Informationen kritisch bewertet und in den Kontext integriert haben.
Alles schließen